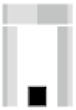Jeanette Wolff: Ich habe Riga überlebt...
Jeanette Wolff: Ich habe Riga überlebt...

Jeanette Cohen war das älteste von sechs Kindern. Mit 16 Jahren, 1904, begann sie ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin in Brüssel und arbeitete anschließend als Kindergärtnerin und Erzieherin. Sie lebte abwechselnd in Brüssel und Bocholt, wo sie den Niederländer Philip Fuldauer kennenlernte. 1908 heirateten die beiden und zogen nach Dinxperlo in die Niederlande. Am 4. Dezember desselben Jahres kam die Tochter Margerieta zur Welt, die jedoch noch als Kleinkind im September des folgenden Jahres verstarb, gut zwei Wochen später starb auch ihr Ehemann Philip. Die junge Witwe zog noch im selben Jahr wieder nach Bocholt. Ebenfalls 1909 legte sie das Notabitur ab. In Dortmund lernte sie den Kaufmann Hermann Wolff kennen, den sie 1911 in Bocholt heiratete. Der Ehe entstammten die drei Töchter, Juliane (geb. 1912), Edith (geb. 1916) und Käthe (geb. 1920). 1932 zog die Familie nach Dinslaken.
Schon kurz nach der Machtübernahme durch die NSDAP wurde Jeanette Wolff wegen ihres Wahlkampfengagements für die SPD verhaftet und zwei Jahre lang in „Schutzhaft“ gehalten. Nach ihrer Entlassung 1935 eröffnete sie eine Pension für Juden in Dortmund. Dort wurde die Familie Opfer der Novemberpogrome 1938. Ihr Mann Hermann wurde kurz darauf in das KZ Sachsenhausen deportiert. Das jüngste der Kinder, Käthe, wurde im Jahr darauf verschleppt und starb 1944 im KZ Ravensbrück. Jeanette und ihre zwei verbliebenen Töchter durchlebten den Zweiten Weltkrieg bis 1945 auf einer Odyssee durch verschiedene Ghettos und Lager. Wolff wurde 1942 nach Riga deportiert und leistete im KZ Riga-Kaiserwald Zwangsarbeit. Nach Auflösung des KZ in Riga wurde sie ins KZ Stutthof verlegt, wo sie ihren Mann zum letzten Mal sah. Bei der Befreiung durch die Rote Armee hatten einzig Jeanette und ihre Tochter Edith aus den Familien Wolff und Cohen den Holocaust überlebt.
Bericht von Jeanette Wolff aus dem Jahre 1947:
Deportation
Im Januar 1942 wurden wir deportiert. Wir waren schon für Oktober 1941 zur Deportation aufgefordert; aus irgendwelchen Gründen wurde der Transport bis Januar 1942 abgeblasen. Da flatterte auch in meine Wohnung der ominöse Evakuierungsbrief der Gestapo: „Sie haben sich am 20. Januar 1942 morgens 8 Uhr, mit ihrer Familie im großen Börsensaal in Dortmund einzufinden, um zum Arbeitseinsatz im Osten verwandt zu werden." Auf diesem Schreiben wurde genau festgelegt, was jeder an Gepäck mitnehmen konnte, 10 RM an Geld waren gestattet, alles andere mußte zur Verfügung der Gestapo bleiben. Ich muß vorausschicken, daß man die meisten Juden schon vorher aus ihren Wohnungen verwiesen und in ein feuchtes Barackenlager am Kanal gebracht hatte. Dort wurden sie zu vielen zusammengepfercht. Wäsche, Möbel und Kleidung wurden zum größten Teil von der Gestapo beschlagnahmt.
Mit meinem Mann und meinen beiden älteren Töchtern trat ich den Weg in die Verbannung an; die Mutter meines Mannes, die 28 Jahre mit uns zusammengelebt hatte, mußte ich zurücklassen. Drei Tage wurden wir in dem großen Börsensaal untergebracht. Bewacht von Gestapo-Beamten hockten wir auf unserem Gepäck. Furchtbar waren die Nächte, die wir zu ca. 1400 Menschen dort zubrachten, ohne die Möglichkeit, die Kleider auszuziehen, verhöhnt und mißhandelt. Wir durften uns notdürftig in der Toilette waschen. Wir wurden untersucht, ob wir mehr als 10 Mark besaßen, die Frauen sogar gynäkologisch. Die Trauringe, die wir nach der Kristallnacht nicht abzugeben brauchten, wurden uns noch genommen. Ein jüdischer Hutmacher wurde vom Gestapo-Kommissar Bovensiepen erschossen.
Musik-Kleininstrumente waren gestattet mitzunehmen, und die Gestapo verlangte, daß unsere Mädel, die im Jüdischen Kulturbund während der Theatersperre für Juden ihren Glaubensgenossen etwas Kunst zugänglich gemacht hatten, ihnen, den Gestapoleuten aufspielten, und sie amüsierten sich in einem besonderen Raum, während die Deportierten zu bewachen waren. Meine Tochter Edith hatte ihre Laute mitgenommen, zu der sie im Kulturbund Lieder sang. Sie - wie auch einige andere aufgeforderten jungen Mädel zerschlugen ihre Instrumente an einem Büffet und lehnten das Ansinnen der Gestapo ab.
Am 27. Januar 1942 um vier Uhr morgens wurden wir auf Umwegen zur Nordseite des Bahnhofs gebracht, in ausrangierte, total verschmutzte 4.-Klasse-Wagen verladen, deren Toiletten bis oben vollgefroren waren; Waggons, die nicht einmal mehr für den Truppentransport brauchbar waren. Aufeinandergepfercht hockten wir in diesen ungeheizten Wagen; nur der sogenannte Sanitätswagen und die Waggons für die begleitende Feldgendarmerie und Gestapoleute waren geheizt. Wohin wir kamen, wußten wir nicht. Erst als wir im Zuge waren, sickerte langsam durch, daß unser Weg nach Riga in Lettland ging.
Alle zur Deportation Vorgesehenen wurden vorher aufgefordert, Matratzen, Öfen, Nähmaschinen, Decken usw. zu kaufen, da sie zum Arbeitseinsatz im Osten vorgesehen seien. Viele Waggons mit diesen Sachen wurden dem Zug angehängt, auch die Koffer kamen mit hinein. Die Jüdische Gemeinde Dortmund hatte auf Befehl der Gestapo mehrere Proviantwagen voll Lebensmittel für den Deportiertentransport aufgetrieben. Alle diese Waggons wurden in Königsberg abgehängt, so daß wir praktisch nur noch das besaßen, was wir, in Rucksäcken verpackt, bei uns trugen, und das, was wir auf dem Leibe hatten. Es war ein außergewöhnlich kalter Winter; unterwegs erfroren schon einige ältere und kranke Leute. Es lag sehr hoher Schnee. In den ungeheizten Waggons eingeschlossen, ohne irgend etwas Warmes, ohne Verpflegung und die Möglichkeit, unsere Notdurft zu verrichten, fuhren wir fünf Tage und Nächte. Als wir die Begleitmannschaften baten, austreten zu dürfen, mußten in jedem Waggon die Aborte mit den Händen ohne Werkzeug gesäubert werden. Das war, abgesehen von dem aufsteigenden Ekel, in der bitteren Kälte eine furchtbare Arbeit. Man ließ schließlich nach langem Bitten aus jedem Waggon einige Leute nach Wasser gehen — wir waren fast verdurstet —, dann durften wir uns für fünf Minuten draußen im Schnee notdürftig säubern und austreten. Männlein und Weiblein gemeinsam; für die Frauen und Mädchen eine schreckliche Angelegenheit. Ging's der SS nicht schnell genug, gab es auch Kolbenschläge. Als Herr Appel aus Dortmund sich weigerte, draußen vor den Augen der Frauen seine Notdürft zu verrichten, und seine Frau davor behüten wollte, von den Männern gesehen zu werden, schlug ein Feldgendarm ihm mit dem Gewehrkolben mehrmals über den Schädel, bis er zusammenbrach. Meine Tochter Juliane verband ihn später und pflegte ihn und seine Frau, die ganz zusammengebrochen neben ihrem Mann auf der Bank hockte. Grausam ging man mit uns um, aber gegen das, was uns in Riga erwartete, war es ein Kinderspiel.
Wir sahen einen tiefblauen Himmel, eine goldene Sonne, die auf eine jungfräulich weiße Schneedecke schien; eine Märchenlandschaft — aber die grausame Wirklichkeit ließ diesen Lichtblick schnell versinken. Mit Peitschen und Ruten wurden wir von SS-Leuten aus den Waggons getrieben. Steif vom tagelangen Sitzen, eng aneinandergepfercht, waren die Menschen kaum mehr in der Lage, von den hohen Trittbrettern des Waggons herabzuspringen. Sie wurden hinuntergestoßen, getreten, geschlagen. Man hörte nur noch das Schreien der SS, das Klatschen der Schläge, das Wimmern der Getroffenen. Das Wenige von unserer Habe, das wir in Rucksäcken und im Handgepäck bei uns trugen, wurde uns unter Schlägen abgenommen oder fallengelassen, wenn scharfe Hiebe mit Ruten, Peitschen oder Gummiknüppeln die tragenden Hände trafen. Meist enthielt das Handgepäck etwas Lebensmittel und Toilettengegenstände. Und trotzdem gelang es einigen von uns, die für uns so kostbaren Dinge ins Ghetto zu retten, wenn auch die Hände mit Striemen bedeckt waren.
Große Schlitten, die wie Flöße aussahen, standen etwas abseits. Der Zweck dieser Schlitten wurde uns klar, als die SS allen Gehbehinderten befahl, darauf Platz zu nehmen. Wir wollten bei unseren Peinigern an etwas Menschliches glauben, doch dann sahen wir, wie ein etwa lOjähriger Junge, der etwas lahmte, roh von der Hand seiner Mutter gerissen und auf den Schlitten geworfen wurde. Die Schlitten wurden in den nahen Wald gefahren, und bald hörten wir die Schüsse, die das Leben der Unglücklichen beendeten. Uns überkam das Grauen. Doch es kam noch schlimmer. Ein etwa 40jähriger Mann aus Dortmund wurde von SS-Leuten aus den Ankommenden herausgeholt und unter dem Ruf „So, Du Rassenschänder" vor unseren Augen erschossen. Ich kannte den Mann, er hatte jahrelang bei uns gegessen, ich wußte, er lebte seit mehr als 15 Jahren mit einer nichtjüdischen Frau zusammen, die durch einen Unfall früh arbeitsunfähig geworden war, und für die er rührend sorgte.

Der erste Deportationszug verließ Gelsenkirchen am frühen Morgen des 27. Jauar 1942 bei klirrender Kälte. Jeanette Wolff und weitere jüdische Menschen mußten beim Halt in Dortmund in den Zug steigen, Waggons wurden angehängt. Über Hannover, wo weitere Waggons angekoppelt wurden und weiter über Königsberg erreichte dieser Zug schließlich mit mehr als 1000 Seelen am 1. Februar 1942 Riga in Lettland.
Riga Moskauvorstadt – das Ghetto
Der Einzug ins Ghetto war nur eine Fortsetzung der Schikanen, denen wir am Bahnhof Shirotawa und unterwegs ausgesetzt waren. Alle Dokumente, Arbeitsbücher, Kennkarten, alles, was als Beglaubigung für unsere Person galt, wurde uns weggenommen, nur einige Photos von den Angehörigen ließ man uns. Unsere Persönlichkeit war erloschen. Getrieben von der SS einerseits und dem Verlangen nach Wärme und Obdach andererseits, strebten alle unter Stoßen und Drängen den für uns bestimmten Häusern am Ausgange des Ghettos zu. Die Häuser waren innen wie ein Trümmerhaufen. Auf den Treppen lagen Wäsche, Kleider und Geschirr nebst Schutt und Steinen. Mit Stockschlägen, Fußtritten und unter Gebrüll wurden wir eingewiesen. Wir, das heißt mein Mann, meine Töchter Juliane und Edith, und ich, bekamen mit noch weiteren 14 Personen drei Räume angewiesen, mit dem Befehl, innerhalb vier Stunden Wohnung und Treppen zu säubern.
Das Ghetto war die frühere sogenannte Moskauvorstand von Riga. Die lettischen Juden wurden von den Deutschen dort eingewiesen; wir sahen an den Kleidungsstücken, Schuhen, Wäsche usw., die in den Schmutz getreten waren, sowie an Büchern und Geschirr, daß hier gebildete Menschen gelebt hatten, die erst kurz vor unser Ankunft von dort vertrieben waren, und zwar ahnungslos. Auf den gedeckten Tischen stand das gekochte Essen. Die Vertreiber hatten zertrümmert, was ihnen in der kurzen Zeit möglich war. Es mußte im Ghetto Platz gemacht werden für die aus Deutschland Deportierten, deshalb wurden die lettischen Juden aus den Häusern in den Tod getrieben.
Das Zusammenleben vieler Menschen in einer Wohnung war nicht leicht. Außerdem gab es kein Wasser, da die Wasserleitungen in den Wohnungen zum Teil zugefroren, zum Teil zerstört waren. Um Wasser zu bekommen, mußte man bei 40 Grad Kälte etwa 10 Minuten gehen. Die Menschen standen in langen Schlangen mit Eimern und anderen Gefäßen, um das kostbare Naß zu erhalten. Wie sollten wir in der uns gestellten Frist die Wohnungen und Treppen reinigen? Viele waren verzweifelt aus Angst vor der SS, aber wir haben es dennoch mit gegenseitiger Hilfe geschafft, den größten Dreck wegzuräumen.
Wir wollten Feuer machen, um die erstarrten Körper etwas zu erwärmen, denn diese Kälte war uns etwas Ungewohntes. Da die Schornsteine innen zerschlagen waren, drang beißender Rauch in alle Räume. Als die SS zur Kontrolle kam, war unsere Wohnung voll Rauch; die SS tobte und schimpfte und als ich sagte, daß die zertrümmerten Kamine Schuld seien, bekam ich meine ersten Backpfeifen. Am Morgen nach der Ankunft kam der Befehl: Lebensmittelempfang. Es gab pro Kopf 215 Gramm klebriges Brot, einen Kabeljaukopf, 30 Gramm Graupen und Rhabarber-Blätter oder Rote-Rüben-Blätter, Abfälle aus Konservenfabriken und großen Hotels. Fett gab es anfangs nicht. Wir hungerten sehr. Ich erinnere mich noch an den ersten Geburtstag meines Mannes im Rigaer Ghetto. Sein Geburtstagsgeschenk war die Hälfte unserer Brotration, auf welche die Mädel und ich verzichteten.
Es war im Ghetto Usus, sobald neue Transporte gemeldet wurden, ermordete man Menschen, um Platz zu schaffen. Später erfuhren wir von Augenzeugen, lettischen Juden, die uns gegenüber, getrennt durch Stacheldraht, ihr eigenes Ghetto hatten, daß aus den Häusern, in denen wir untergebracht waren, etwa 30 000 Menschen (Juden) von der lettischen SS unter Leitung der deutschen SS beraubt, geplündert, ausgezogen und dann im Bickernicker Wald bei Riga ermordet worden waren. In der Hauptsache handelte es sich um Frauen und Kinder. Die Opfer mußten selbst die Gruben auswerfen, sich jeweils zu fünfzig am Rande dieser Massengräber aufstellen, und dann begannen die Maschinengewehre ihr grausames Werk. Lebende und Tote wurden miteinander begraben. Die lettische SS, Abschaum der Menschheit, zum Teil von der deutschen SS aus den Zuchthäusern Lettlands befreit für den grausamen Beruf der Lösung der Judenfrage, waren die Henkersknechte. Die deutschen SS-Führer, der Ghettokommandant Krause, der Oberscharführer Seekt, der spätere Kommandant des Lagers Jungfernhof, der zynische Obermörder SS-Major Dr. Lange und viele andere gleichen Kalibers saßen in warmen Pelzmänteln und Winterstiefeln, Zigaretten rauchend, auf den Bänken des Parkes und schauten vergnügt dem Treiben ihrer betrunkenen Henkersknechte zu.
Der Höhepunkt des Spiels war das Schießen nach lebenden Kindern. Zwei SS-Leute warfen sich die lebenden Zielscheiben, kleine Kinder, zu, während ein dritter schoß. An diesem grausamen Sport hat sich auch die deutsche SS aktiv beteiligt. Mein Schwiegersohn war auch einer von den Überlebenden, er hat sich nach dem Fortgang der SS von den über ihm liegenden Leichen befreien können und gelangte in der Nacht auf Umwegen ins lettische Ghetto. Seine Mutter und beide Schwestern waren unter den Ermordeten. Das, was sich vor den Erschießungen an Vergewaltigungen, Schreien, Nervenzusammenbrüchen von wahnsinnig gewordenen Menschen abgespielt hat, wiederzugeben, ist unmöglich.
Das Ghetto bestand aus verschiedenen Bezirken, die nach den Transporten, die ankamen, benannt wurden. Der Hannoversche, der Sächsische, der Bielefelder, der Kölner, der Kasseler, der Berliner und der Dortmunder Bezirk. Es waren etwa elf Transporte zu je ungefähr 2000 Menschen aus diesen Gegenden ins Rigaer Ghetto geschickt worden. Viele sind gar nicht erst bis dorthin gekommen. Viele Männer wurden gleich bei der Ankunft in die Hölle von Salas Pils geschickt. Von diesen sind nicht 20 Prozent übriggeblieben.
Viele Transporte kamen. Es war im Ghetto kein Raum mehr vorhanden, wohnten doch schon drei und mehr Familien in einem Zimmer. Der Kommandant des Ghettos, Karl Wilhelm Krause, früher Heilgehilfe im Krankenhaus zu Herne (Westfalen), später Rittergutsbesitzer in Oberschlesien, hatte eine herrliche Methode, Raum zu schaffen. Im Einverständnis mit dem Leiter der SS Riga, Dr. Lange, der wiederum nach Anweisungen Himmlers handelte, wurden entweder Aktionen gemacht, um das Ghetto zu dezimieren, oder ganze Transporte gleich vom Bahnhof Shirotawa in den Bickernicker Wald geführt. Von einem Berliner Transport, etwa 1300 Menschen, darunter 750 Kinder aus dem Berliner Waisenhaus, sind nur durch Zufall 80 kräftige Männer übriggeblieben und nach Illgeziem in die Zementwerke geschickt worden. Ins Ghetto kamen nur die Kleidungsstücke und Schuhe von etwa 750 Kindern und etwa 450 Frauen und Männern. Die Wäschestücke waren zum Teil blutverschmutzt.
Berliner Aktion
Im Januar 1942 wurde in den Berliner und Wiener Bezirken eine Aktion der SS durchgeführt. Hunderte von älteren oder durch Erfrierungen und Entbehrungen erkrankten und entkräfteten Menschen wurden mit dem Gummiknüppel auf die Blechautos getrieben und ebenfalls im Bickernicker Wald erledigt. Meine beiden Töchter mußten als Sanitäterinnen in den verlassenen Häusern nach Leichen und Kennkarten suchen. Sie fanden Leichen, zur Unkenntlichkeit zerschlagen, andere, denen die Ringfinger fehlten, da man die Finger gleich mit abgeschnitten hatte, wenn der Ring zu fest saß, ja, sogar die Zahnbrücken, an denen Gold war, hatte man den noch warmen Leichen ausgebrochen. Später, im Frühjahr, als Eis und Schnee schmolzen, fanden sich viele abgeschnittene Finger. Es wurden Sterne frei, von denen noch nach zwei Jahren sich die Blutflecke nicht entfernen ließen. Kleine Aktionen und Exekutionen fanden alle Tage statt, darum will ich erst von den größeren berichten.
Verschickung nach Dünamünde
Jeder Bezirk hatte sein eigenes Verwaltungsbüro, dem ein sogenannter Ältester vorstand. In diesen Büros waren die Bewohner eines jeden Bezirks registriert, selbstverständlich in Angleichung an die Gesamtkartei der Kommandantur. Von diesen Bezirksbüros aus vollzog sich auch auf Befehl der Kommandantur die Einreihung in die Arbeitskommandos. Die Büros erhielten den Befehl, Menschen, die geschwächt oder schon älter waren, für leichte Arbeit in Konservenfabriken in Dünamünde auszusuchen. Alle, die man unbedingt verschicken wollte, waren von der Kommandantur namentlich bezeichnet. Fachkräfte wurden gebraucht und daher meistens von solchen Aktionen verschont. Ich hatte für mich als Beruf Uniformschneiderin angegeben, und so blieb ich verschont.
Hatte ein ungerechter Ältester irgend jemand, den er erledigen wollte, so kam dieser mit auf die Verschickungsliste. Auch mein ältestes Mädel war vom Chefarzt Dr. Aufrecht mit auf die Liste gestellt worden, und nur durch Rücksprache mit dem Polizeioberleutnant Heser, der mit dem Kommandanten sprach, blieb mir meine damals 28jährige Tochter erhalten. Von der Schutzpolizei erfuhren wir dann, daß es sich bei dieser Verschickung um planmäßige Ausrottung handelte. Unsere seelische Verfassung war nicht zu beschreiben.
Als die Transporte bereitstanden - meist handelte es sich um Frauen und Männer über 50 Jahre und Schwache -, gingen auch den Ahnungslosesten die Augen auf. Alle waren Todeskandidaten. Decken, Taschen, Proviant, alles wurde den Unglücklichen von der SS abgenommen. Mit Schlägen und Püffen wurden sie nacheinander auf Lastautos verladen, die jeweils nach 30 Minuten zurückkamen, um neue Opfer zu holen, bis auch die letzten weggeschafft waren. Der Jammer und das Weinen der zurückgebliebenen Angehörigen liegt mir noch heute in den Ohren. Die Fahrzeit bis zum Orte Dünamünde betrug mit dem Auto über eine halbe Stunde; niemals ist jemand von dort zurückgekommen, nie sind Juden in Dünamünde angekommen. Wohl aber wurden daraufhin im Ghetto sogenannte Hochwaldkommandos gebildet, die ausschließlich aus kräftigen jungen Männern bestanden. Diese mußten nackte Leichen eingraben und mit Chlor und ätzenden Chemikalien begießen. Von diesen Kommandos kamen auch nur durch Zufall einige Männer zurück. Diese Aktion Dünamünde hat ungefähr 5.000 Opfer gefordert.
Salaspils
Immer wieder wurden kräftige junge Männer in die Hölle von Salas Pils geschickt. Die Behandlung war dort furchtbar, denn schon für die geringsten Verfehlungen wurde die Todesstrafe verhängt. Dünne Suppe aus Rhabarberblättern oder sonstigen Abfällen, 220 g Brot täglich, Übernachten in verschmutzten Scheunen mit nur einer Decke, keine Reinigungsmöglichkeit, kein Trinkwasser, schwere Arbeit in Ziegelei oder Steinbruch, das war das "Leben" dieser Unglücklichen. Wurde man krank, bekam man zu allen sonstigen Quälereien auch nur halbe Ration. 80 Prozent dieser Menschen gingen elend zugrunde, da keinerlei sanitäre Anlagen vorhanden waren. Typhus und Dysenterie waren die Todesursache bei der einen Hälfte, die anderen wurden totgeprügelt, erhängt oder, wenn sie Glück hatten, erschossen. Ungefähr 7.000 bis 8.000 Menschen kamen dort in den Jahren 1941 bis 1943 um. Viele Verwandte und nähere Bekannte von mir waren darunter.
Nur einiges über das Leben im Ghetto: Die ersten 14 Tage gab es keinerlei Verpflegung. Wir suchten aus den Unrathaufen verfrorene Kartoffelschalen, Gemüseabfälle usw., reinigten, kochten und aßen sie. Auch fanden wir hier und dort unter den Trümmern noch Reste von Mehl oder Grütze. Wir vermischten Kartoffelschalen mit etwas Mehl und buken ohne Fett daraus einen Kartoffelpuffer. Manchmal fuhren auch Militärautos mit Brot durch das Ghetto. Wenn sie hielten, holten wir uns Brot. Als erste Verpflegung bekamen wir verschimmeltes Brot, 220 g auf den Kopf und Tag, später kamen Fisch- und Bücklingsabfälle aus den Räuchereien hinzu. Rhabarber- und Rote-Rüben-Blätter, Spinat- und Kohlabfälle, Sauerkraut, aber fast nur stinkend und verdorben, das war dann unsere Nahrung. Wären wir nicht auf Arbeitskommandos hinausgekommen, wir wären alle verhungert. Es starben trotzdem sehr viele Menschen an Entkräftung und vor allen Dingen auch an Erfrierungen.
Verbote gab es im Ghetto genug. Einige davon will ich der Nachwelt nicht vorenthalten, da sie zu gut in das Kulturniveau der Nazis hineinpassen. An jede Schlafstelle nun einen Posten zu stellen, war selbst dem Kommandanten Krause unmöglich, aber nächtliche Kontrollen zur Verhinderung der Paarung sollten als Ersatz dafür dienen. Kinder durften nicht geboren werden, Schwangerschaftsunterbrechungen, auch im sechsten Monat und noch weiter, wurden ohne Narkose unter Teilnahme von interessierten SS-Leuten durchgeführt. Der Kommandant war außerdem auch fast bei jeder Operation anwesend.
Einer mir bekannten jungen Frau wurde im siebenten Monat eine Schwangerschaftsunterbrechung gemacht, selbstverständlich auch ohne Narkose, und sie zur Strafe nach diesem qualvollen Eingriff nach vier Tagen in ein Torflager verschickt. Sie arbeitete etwa drei Wochen bis an die Hüften im Wasser; todkrank, mit 41 Grad Fieber wurde sie ins Ghetto zurückgebracht. Sie genaß nach dreimontigem schwerem Krankenlager wie durch ein Wunder, jedoch wird die jetzt 29jährige Frau nie wieder Kinder haben; ein blutendes Myom und die Verletzung wichtiger Drüsen waren die Folgen dieses rohen Eingriffs. Das war nur eine von vielen.
Im übrigen hat man Menschen, die nicht voll arbeitsfähig waren, ins Lazarett eingeliefert, wo sie zumeist schon nach wenigen Stunden "starben". Junge Mädchen, die infolge von Menstruationsstörungen oder seelischen Qualen Nervenzusammenbrüche erlitten, und die man ins Lazarett einlieferte, wurden sehr häufig auch durch eine Spritze ins Jenseits befördert. Alle diese Dinge verfügte der Kommandant nicht nur, nein, er liebte es sehr, bei allem Augenzeuge zu sein.
Alle diejenigen, die zur Arbeit eingeteilt waren, waren glücklich, gab es doch außerhalb des Ghettos die Möglichkeit, etwas zu essen für sich und die Angehörigen mitzubringen. - Es gab gute Kommandos, auf denen man zu essen bekam und nicht geschlagen wurde, diese hauptsächlich bei der deutschen Wehrmacht. Auch das Reinigen der Gleise und Schienenstopfen bei der lettischen Eisenbahn war eine beliebte Arbeit, da man dort mit der lettischen Bevölkerung Kleidungsstücke, Wäsche usw. gegen Lebensmittel eintauschen konnte. Viele von uns hatten noch verwendbare Sachen im Ghetto gefunden, außerdem gab es eine Kleiderkammer, von der wir ab und zu etwas bekamen. Unsere Sachen hatte man uns ja schon bei der Ankunft abgenommen, mit Ausnahme von dem, was wir auf dem Leibe trugen. Die meisten hatten bei der Abfahrt alles drei- und vierfach übereinandergezogen und vertauschten nun im Ghetto die übrigen Kleidungsstücke gegen Lebensmittel.
Tauschhandel wird mit dem Tode bestraft! stand an jedem Hause, an jedem Zaun, aber den Hungrigen hindert kein Verbot, und sehr viele hatten das Glück, bei den abendlichen Kontrollen beim Einmarsch ins Ghetto nicht aufzufallen. Wenn aber der Kommandant selbst kontrollierte, dann hagelte es Prügelstrafen und Todesurteile, die der Kommandant stets selbst vollstreckte. Mit ironischem Grinsen führte er die Männer und Frauen selbst auf den Friedhof, und dort erledigte er sie durch Genickschuß, nachdem die Opfer sich ihrer Oberkleider entledigt hatten und mit dem Rücken zu ihm niedergekniet waren. - Außerdem war jeden Sonnabend Gerichtstag, und das Entsetzen durchfuhr uns, wenn wir vom Arbeitskommando ins Ghetto zurückkamen und am Galgenberg vorbeigeführt wurden. Wegen geringfügiger Dinge, wegen einer Schachtel Zigaretten z.B., wurden oft Leute erhängt. Jeder von uns, der beim Vorbeimarsch nicht zum Galgen hinaufschaute, bekam von den SS-Posten einen Schlag unters Kinn, so daß ihm schon von selbst der Kopf in die Höhe flog.
Der Kommandant bestimmte einen Juden, der eine zahlreiche Familie hatte, als Henker. Im Weigerungsfalle wurde die ganze Familie erschossen, und so fügte sich der Unglückliche. Auf diese Weise entstanden auch Bilder in den deutschen illustrierten Zeitungen, die wir zufällig später einmal in die Hand bekamen, mit der Unterschrift "So richten Juden Juden", denn von allen Exekutionen wurden Aufnahmen gemacht.
SS-Kommandos
Viele Juden, die an irgendwelchen Dienststellen der SS arbeiteten, verloren ihr Leben. Zumeist waren dort Magazine, in denen Lebensmittel, Rauchwaren und sonstige Dinge aufgespeichert waren, denn die SS wurde großartig versorgt. Sie schwamm in Butter, Fleisch, Fett, Delikatessen, Tabak und Süßigkeiten. Ich selbst habe einige Zeit in einem SS Kommando gearbeitet, wo man für sechs SS-Leute zu einer Mahlzeit zwei große Gänse in Butter gebraten gab. Sie lebten, wie man sagt, wie die Maden im Speck, abseits von Front und Gefahr. Den Ruhm des Heldentodes überließen sie den Wehrmachtsoldaten, dafür bestand für sie die Gefahr des Rasseschandeparagraphen der Nürnberger Gesetze.
Viele schöne, junge Mädchen und Frauen gab es unter den Jüdinnen. Für die Kommandos bei der SS wurden zuerst nur solche ausgesucht. Bs bestanden sogar Kommandos, zu denen vom Kommandanten ausdrücklich nur schöne Mädchen verlangt wurden. Manche Mädchen wurden sogar namentlich angefordert. Da die SS geborgen hinter der Front im Paradiese lebte, im Übermaß zu essen, zu trinken und zu rauchen hatte, mußte man für ein Ventil sorgen, damit sie, wie der Westfale so schön sagt, der Hafer nicht zu sehr stach. Man setzte den Rasseparagraphen, aufgrund dessen Tausende von Menschen in Deutschland die Zuchthäuser und Konzentrationslager bevölkerten, stillschweigend außer Kraft, und schöne, junge Jüdinnen mußten der SS die rassereine Verbindung ersetzen. Überall gingen die Kommandanten ihren Mannschaften mit "gutem Beispiel" voran. Die SS-Liebchen wurden des öfteren ausgewechselt, manchmal bekamen sie je nachdem ein gutes Arbeitskommando, manchmal auch wurden sie auf Nimmerwiedersehen in irgendein Kasernierungslager geschickt.
Immer wieder muß ich anführen, daß bei der SS Theorie und Praxis zweierlei war. Man ließ zur Bewachung und als Vorarbeiter in den Judenlagern Schwerverbrecher und vorbestrafte Straßendirnen aus den deutschen Zuchthäusern kommen, die sich uns gegenüber vorkamen wie Halbgötter und sich häufig noch schlimmer benahmen als die SS. Zwei dieser Individuen gerieten einmal in Streit um eine Halbjüdin aus dem Lager. (Es war bei der Firma Beton- und Monierbau in Riga.) Das Mädel wurde von der SS sofort erschossen, die beiden Kapos gingen straffrei aus. Ein kleines Beispiel nur, wie es auf den SS-Kommandos zuging: Auf einem Kommando waren Lebensmittel und einige Zigaretten verschwunden. Ohne Untersuchung wurde aus dem Kommando jeder siebente Mann ausgezählt, in den Bunker gesteckt und nach drei Tagen erschossen. Dieses alles schreibt sich so leicht, aber wieviel Leid der Tod dieser vierzehn jungen Menschen im Ghetto verursachte, ist unbeschreiblich.
Bei der Waffen-SS in Riga arbeitete ein Reinigungskommando, dem auch ich zugeteilt war. Dort waren Unterkunftsräume für SS und Wehrmacht. Allerdings hatte die SS ihre Räume gesondert von denen der Wehrmacht, die wir auch reinigen mußten. Kurz nachdem die große Aktion im Warschauer Ghetto durchgeführt war, kamen die Mörder von Warschau zu uns in die Unterkunft. Ihre Uniformen waren die der Feldgendarmerie. Ein Oberwachtmeister aus Westfalen sprach mich an und fragte, ob ich nicht auch aus Westfalen sei. Im Laufe des Gesprächs sagte er mir: "Wie auch der Krieg ausgehen mag, ich kann nicht mehr leben. Wenn wir den Krieg verlieren, kann ich nicht mehr nach Deutschland zurück, da wir auf Befehl der SS, in die man uns übernommen hat, als Exekutionstruppe im besetzten Ausland tätig waren und jeder uns dann dort mit Recht Mörder schimpfen würde. Gewinnen wir den Krieg, so werde ich die Todesschreie der etwa 65.000 gemordeten Menschen aus dem Warschauer Ghetto nicht mehr los. Allnächtlich höre ich das Wimmern lebendig Verbrannter, sehe ich die verzerrten Gesichter der Erschlagenen, die durch Handgranaten zerfetzten Leiber von Männern, Frauen und Kindern. Ich kann nicht mehr leben." Am nächsten Morgen fanden wir ihn erhängt am Fensterkreuz eines leeren Raumes.
Himmelfahrtskommandos
Anfang April 1942, Eis und Schnee waren noch nicht geschmolzen, wurde vom Kommandanten ein besonderes Kommando von etwa 40 jungen, kräftigen Männern verlangt. Dieses Kommando nannte sich Krause I. Mit einer Decke ausgerüstet und Verpflegung, die sie für einen Tag empfingen, zogen diese Männer, meistens Jungverheiratete, hinaus. Vergebens warteten die Frauen Tag um Tag auf die Männer, sie blieben verschollen. Endlich, nach etwa vier Monaten, wurden einige fast sterbend ins Lager zurückgebracht. Diese Männer waren zu Skeletten abgemagert, die Körper mit widerlich stinkenden, eiternden Wunden bedeckt, bei den meisten der Geist verwirrt. Sie hatten schreckliche Arbeit an Leichen, wahrscheinlich aus verschollenen Transporten, machen müssen. Schlecht ernährt, täglich mißhandelt, schliefen sie nachts in den feuchten Kellergelassen der Gestapo im Zentralgefängnis in Riga auf nacktem Steinboden, zu 40 Mann in einer Zelle, die vielleicht zur Not für zehn Menschen ausgereicht hätte. Diese Zelle war erfüllt von bestialischem Gestank der Kotkübel und der eiternden Wunden der Kranken. Es war kaum möglich, die Toten herauszutragen, da die Männer schon um 4 Uhr morgens zur Arbeit getrieben wurden. Einer der Überlebenden, Kurt Meier aus Witten, erzählte, daß sie durch Hunger und Kälte dort fast alle zu Tieren geworden seien, und einer habe auf den Tod des anderen gewartet, um sich in den Besitz der noch vorhandenen, total zerlumpten Kleidung zu setzen. Außerdem habe man diese Männer durch Schläge und sadistische Quälereien an den Rand des Wahnsinns gebracht. Hungertyphus und Dysenterie brachen aus, und ohne ärztliche Hilfe oder Pflege gingen bis auf sieben alle diese Menschen zugrunde. Von diesen sieben sind dann noch drei an Entkräftung gestorben, da für sie die Hilfe zu spät kam.
Von allen solchen Himmelfahrtskommandos kamen die Menschen nicht zurück, wurden zu Tode gequält oder erschossen, sobald man ihrer nicht mehr bedurfte. Der Jungfernhof war ebenfalls ein KZ, in dem der Oberscharführer Mörder Seekt Kommandant war. Auch er war ein Ausbund von Sadismus und Perversität. Ganze Transporte aus Süddeutschland kamen zum Jungfernhof. Auch von dort wurden Hunderte von Menschen, ältere Männer und Frauen, auch Kinder, nach Dünamünde verschickt. Exekutionen über Exekutionen fanden dort statt. Ein besonderes Vergnügen des Kommandanten war, ältere Männer, die in die Baracken kamen, um sich zu wärmen, sofort zu erschießen. Der Rasseschandeparagraph wurde selbstverständlich auch hier außer Kraft gesetzt. Hübsche junge Mädchen dienten ihm und seinen Freunden als Zeitvertreib. Nachdem er nun übersättigt von allem war, hat er selbst Paare zusammengegeben, deren intimstes Zusammenleben ihn als Zuschauer hatte. Zumeist gab er einem jungen Manne, dessen Frau oder Freundin nicht mit ihm nach Jungfernhof gekommen war, irgendein fremdes Mädel. Es genügte diesen Menschenbestien nicht, Menschen zu quälen und zu töten, Familien auseinanderzureißen, sie machten auch unsere jungen Mädchen und Frauen zu Dirnen, lediglich zu ihrem eigenen Nervenkitzel.
Das Ghetto wird aufgelöst
Auf Befehl der Berliner Naziregierung sollte das Ghetto mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden. Im Ghetto selbst waren im Laufe der Zeit sogenannte Zentralwerkstätten entstanden, die zu einem Teil für die SS und die Wehrmacht und zu einem kleinen Teil auch für die Insassen des Ghettos arbeiteten. Diese Werkstätten wurden nach dem Straßenhof, einem Konzentrationslager in der Nähe von Riga, verlegt. Im ganzen umfaßte das Lager 1500 Menschen, von denen zuletzt vielleicht ein Viertel am Leben blieb. Hans Bruhns, angeblich ein politischer Häftling, aber ein Menschenschinder und Rohling, wie man ihn sich schlimmer nicht denken kann, war dort im Straßenhof der Lagerälteste, andere Zuchthäusler und vorbestrafte Straßendirnen die Kapos. Mißhandlungen waren dort an der Tagesordnung.
Außerdem hatte sich dort ein Günstlingssystem herauskristallisiert. Die Liebste des Lagerältesten war eine polnische Jüdin. Selbstverständlich ging es ihr sowie ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis glänzend. Auch in diesem Lager wurden wegen geringfügiger Vergehen Todesstrafen verhängt und Aktionen zur Dezimierung des Lagers durchgeführt. So wurden dort zuletzt alle über 30 Jahre alten Menschen verschickt, wohin, weiß bis heute niemand. Ich selbst war später im KZ Stutthof mit Straßenhofern zusammen, die Furchtbares von dort berichteten. Die Verschickung nach dem übel beleumundeten KZ Kaiserwald ging der Auflösung des Ghettos voraus. Jeden, der dorthin verschickt werden sollte, erfaßte eine wahnsinnige Angst, hatten wir doch im Ghetto zur Genüge die Jammergestalten gesehen, die als arbeitsunfähig von dort zurückgekommen waren, zerrüttet an Leib und Seele.
Sämtliche Torflager wurden aufgelöst und ihre Insassen auch in den Kaiserwald verschickt. Das Konzentrationslager Kaiserwald bei Riga. Unser erster Lagerältester war Reinhold Rosenmeyer, ein Stehbierhallenbesitzer aus Hannover, der wegen Doppelmords zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt war. Er liebte die Weiber und den Suff, er hielt sich einen Harem von hübschen Jüdinnen, die abwechselnd die Nächte bei ihm zubrachten. Wenn man von diesen Dingen absah, benahm er sich den Häftlingen gegenüber nicht schlecht. Seine Weibergeschichten interessierten die SS nicht, wohl aber, daß er von ihrem Standpunkt aus zu den Lagerinsassen zu menschlich war, und so wurde er an das Lager Straßenhof versetzt, und der dortige Lagerälteste Hans Bruhns übernahm als Lagerältester das Lager Kaiserwald. Seine Liebste, die schon, wie erwähnt, eine charakterlose polnische Jüdin war, brachte er sich gleich mit. Dieser Hans Bruhns wollte, wie schon gesagt, als politischer Häftling gelten. Wir alle aber nahmen an, daß es sich um einen Berufsverbrecher handelte, da fast alle politischen Häftlinge den Lagerinsassen gegenüber nicht schlecht waren. Er aber war ein ausgesprochener Menschenschinder. Wegen der geringfügigsten Vergehen wurden von ihm die Männer halbtot geschlagen, er ohrfeigte die Frauen bei jeder Gelegenheit und machte sich so bei der SS sehr schnell einen guten Namen. Außer ihm waren noch da Hannes Filsinger, auch BVer, der die Kolonne Luftpark I führte. Er war ja keiner von den Schlimmsten, aber auch er hat rücksichtslos geschlagen, wo er nur konnte. Hannes und Bernd waren auch zwei Berufsverbrecher, deren Zunamen ich nicht weiß, die beide die Marschkolonne Spilve (Flughafen) beaufsichtigten.
Wenn ich von ihnen als bedingt anständig spreche, so nur deshalb, weil Püffe, Fußtritte und Ohrfeigen von uns schon gar nicht mehr als Mißhandlungen empfunden wurden. Der Leiter des Arbeitseinsatzes war der BVer Schlüter, auch er unterschied sich durch nichts von den Vorgenannten. Dann war noch ein politischer Häftling Hans Marr aus Düsseldorf dort, der zwar nicht so roh wie die anderen, aber auch schon von ihnen angesteckt war. Der Schlimmsten einer war Mister X., auch Berufsverbrecher, ein schönes Raubtier, gepflegt, elegant. Er war der internationale Hochstapler und Autodieb Xaver Abel. Die Aufzeichnungen über das Konzentrationslager Kaiserwald verdanke ich meiner Tochter Edith, die anderthalb Jahre dort zubrachte und alle Dinge aus nächster Nähe miterlebte. Sie war als Oberschwester für das Häftlingsspital verantwortlich. Über dem Tor von Kaiserwald stand, wie in allen KZ-Lagern, unsichtbar geschrieben: "Wer hier eingeht, der lasse alle Hoffnungen hinter sich!"
So dachten auch wir, als es hieß, alle Torfkommandos werden aufgelöst und zum Kaiserwald verschickt. Wir kamen, etwa 200 Männer und Frauen, vom Torflager Olaine bei Einbruch der Dunkelheit in Kaiserwald an. Die SS mit ihren Schergen, Schwerverbrechern, Zuhältern usw. aus deutschen Zuchthäusern, prügelten uns buchstäblich von den Autos herunter. Wahllos klatschten die Schläge auf Gesicht und Körper, ein kleiner Vorgeschmack dessen, was uns erwartete. Dreimal wurden wir an diesem Abend mit Schlägen von einer Stelle des Lagers zur anderen zum Zählappell getrieben und dann für die Nacht mit den Männern zusammen in eine Baracke eingesperrt.
Unsere direkten Vorgesetzten waren, wie schon gesagt, Schwerverbrecher und Zuhälter aus deutschen Zuchthäusern und kriminell gewordene Dirnen. Zum Teil wurden diese Menschen, die jahrelang als Parias betrachtet worden waren, zu Sadisten, als ihnen Tausende wehrloser Menschen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert wurden. Wir haben des öfteren gesehen, wie die Männer, die durch Stacheldraht von uns getrennt waren, von diesen Bestien so lange geschlagen wurden, bis sie blutüberströmt zusammenbrachen. Ich selbst habe im Revier häufig solche Unglücklichen verbunden. Viele von denen, die infolge der Mißhandlungen nicht gestorben sind, blieben für den Rest ihres Lebens bresthafte Männer. Wie viele Häftlinge sind durch Fußtritte in den Unterleib und dadurch sich ergebende Komplikationen und Operationen für alle Zeit ihrer Mannbarkeit beraubt worden. Ebenso werden viele der überlebenden Frauen für die Zukunft kinderlos bleiben, weil durch die vielen Aborte, die als Folgen gezwungener oder freiwilliger Liebesidylle mit SS-Leuten oder Verbrechern vorgenommen werden mußten, organische Störungen hervorgerufen wurden.
Mister X. war ungemein kräftig, da ja die Henker der SS genauso gut aßen und tranken wie ihre Herren. Er war der gefürchteteste Exekutor im Lager. Die kräftigsten Männer schlug er mit der Faust zu Boden, oft sogar ohne jede Ursache. Er schlich wie ein Raubtier um jeden herum, so daß manche schon am Boden lagen, ehe sie wußten, was ihnen geschah. Viele Menschen hat er auf dem Gewissen. Jungen und hübschen Mädchen und Frauen gegenüber hatte diese Bestie ihre Achillesferse: diese wollte er gern für sich, ihnen brachte sie Lebensmittel und Kleider. Hingegen mußten ältere Frauen, die für diese besondere Verwendung der SS und ihrer Schergen nicht mehr in Frage kamen, schwere Arbeit verrichten, bei der sie oft mitleidlos mißhandelt wurden. Die Übertretung des „Rasseschandeparagraphen" der Nürnberger Gesetze interessierte die SS nur insoweit, als ihnen die Vorarbeiter nicht ins Gehege kamen. Mehr interessierte sie, daß nach ihrer Ansicht die Verbrecher uns Frauen gegenüber noch nicht roh genug waren. Darum ließen sie kriminelle Dirnen aus Zucht- und Arbeitshäusern kommen als unsere Vorgesetzten. Selbstverständlich waren auch sogenannte "Blitzmädel" Aufseherinnen im Lager, sie schlugen uns genau so unbarmherzig wie die Dirnen und plünderten jeden Transport aus, der ankam. Je älter und reizloser unsere weiblichen "Vorgesetzten" waren, um so gemeiner und sadistischer benahmen sie sich.
Ein Intermezzo will ich nicht vorenthalten. Der erste kriminelle Dirnenimport aus Deutschland betrug 40 dieser Prachtexemplare, die selbstverständlich im Frauenlager untergebracht wurden, hingegen schliefen sie inoffiziell im Männerlager bei den Kapos. Gleich am ersten Abend rückten die Weiber aus. Die SS kontrollierte die Frauenbaracken, 32 unserer neuen Vorgesetzten fehlten. Die SS machte sich auf die Suche. Was war geschehen? Sobald die Kapos von der Razzia hörten, steckten sie ihre nackten Weiber zu den jüdischen Männern in die Kojen. Der SS-Kommandant Sauer wußte aber sofort, was gespielt wurde, und handelte danach. Jetzt suchte man noch die letzten zehn Frauen, und siehe da, sie waren von unseren Sträflingen nackt in die 500 Liter fassenden Kochkessel in der Häftlingsküche versteckt und die Deckel geschlossen worden. Als sie herausgekrochen kamen, wurden ihnen zur Strafe die Haare abgeschnitten, aber auch das half nicht, denn schon am nächsten Abend waren sie wieder im Männerlager. In der Nacht, als die Torfkommandos eingeliefert wurden, nahmen diese Dirnen sich unsere kräftigsten Männer aus der gemeinsamen Baracke heraus mit in ihre Betten. Die, welche sich weigerten, würden mit Schlägen und Drohungen gefügig gemacht.
Am nächsten Morgen wurden wir von den Dirnen zur Entlausung geführt, um im Lagerjargon zu reden, "gefilzt", das heißt, es wurde uns alles abgenommen, was wir besaßen, buchstäblich nackt gingen wir zur Entlausung. Anschließend wurden wir "eingekleidet". Selbstverständlich vollzog sich alles mit Schreien, Schimpfen und Schlägen in Gegenwart der SS und ihrer Schergen. Dann wurde einer nach dem andern mit Kleidung versehen. Ganz nach Willkür warf man uns ein Kleidungsstück zu, ob es lang, zu kurz, zu eng oder zu weit war, gleichgültig. Als wir eingekleidet waren, sahen wir aus, als ob man uns zu einem Lumpenball ausstaffiert hätte. Jede Bitte um ein passendes Kleidungsstück wurde mit Schimpfen und Schlägen beantwortet. Einer sah den anderen an. Große Frauen trugen Oberkleider, die wie Tanzröckchen wirkten, unter denen die Wäsche hervorging, kleinen hingen die Kleider bis auf die Erde, die Ärmel bis über die Fingerspitzen. Ein Zug von traurigen, degradierten Frauen verteilte sich wie geprügelte Hunde auf die verschiedenen Blocks. Am anderen Morgen erfolgte Einreihung in die verschiedenen Arbeitskommandos. Zwei Wochen lang mußten wir in bitterster Kälte ohne Mantel auf den Außenkommandos unter Aufsicht der Verbrecher schwer arbeiten, deren Launen wir schutzlos ausgeliefert waren.
Einige kleine Ausschnitte aus den Kommandos
Lufttanklager war ein Kommando unter Leitung von Hans Marr, einem politischen Häftling, einem Journalisten aus Düsseldorf. Ich erwähne ihn, da er einer der wenigen war, die die Sträflinge nicht schlugen, aber sonderbar war uns, daß jede Kleinigkeit aus diesem Kommando zu Ohren der SS kam, daß diesem Kommando immer alles abgenommen wurde, was die Menschen mit ins Lager brachten, und im Lager gab es dann dafür Prügel und Arrest. Hans Marr war für uns ganz undurchsichtig. Vielleicht irrten wir uns in bezug auf ihn, aber wir waren mißtrauisch, wußten wir doch, daß all die Verbrecher und Dirnen nur dadurch frei geworden waren, daß sie versprachen, alle Befehle der SS rücksichtslos durchzuführen.
Das Männerlager war durch einen doppelten Stacheldrahtzaun vom Frauenlager getrennt, und wir mußten zusehen, wie unsere Männer, wenn sie vom Arbeitskommando müde und hungrig und verprügelt zurück ins Lager kamen, nach Feierabend schwere oft unsinnige Arbeit unter Schlägen und Quälereien aller Art ausführen mußten. Manche brachen darunter zusammen, aber Stiefeltritte und eimerweise kaltes Wasser dienten den entsetzlichen Peinigern als Wiederbelebungsmittel. Viele Männer erkrankten und gingen ein infolge schwerer Überarbeitung, die die von Hunger, Kälte und seelischem Leid geschwächten Körper nicht ertrugen. Eine beliebte "Arbeitsbeschaffungsmethode" der SS war, von den Häftlingen Steine von einer Seite des Lagers zur anderen tragen zu lassen; hin und zurück, auf- und abladen, dazu in den Händen der Hitlerschergen als Antriebsmittel der Gummiknüppel. Jeden Abend beim Einmarsch ins Lager wurden die von den Außenkommandos Kommenden kontrolliert. Wurde etwas gefunden, gab es als müdeste Strafe Bunkerhaft ohne Essen.
Eine andere Strafe für die kleinen Verfehlungen waren 25 Hiebe. Die Männer oder Frauen wurden auf einen Bock geschnallt, und meistens erteilten fünf SS-Leute je fünf Hiebe, wahrscheinlich damit die Schläge auch kräftig genug ausfielen. Dazu kam im Winter das Abgießen mit kaltem Wasser, eine Strafe, die meistens nur bei Männern angewandt wurde. Oft ließ man die Begossenen draußen stehen, bis das Wasser gefror, holte sie dann herein und taute sie auf. Erholte sich einer nach dieser Prozedur wieder, so blieben doch meistens dauernde organische Schäden zurück. Ein Teil der Tuberkuloseerkrankungen in den Lagern datiert wohl von solchen Behandlungen. Bei der vorgenannten drakonischen Behandlung ist es auch oft vorgekommen, daß die Begossenen nach kurzer Zeit tot umfielen. Eine der vielen Arten, das an sieh schon so schwere Leben der KZ-Insassen noch zu erschweren, war das nächtliche Herausholen der Häftlinge aus den Kojen. So wie man war, im Hemd oder nackt, mußte man dann mehrere Stunden auf dem Appellplatz stehen.
Ernährungs- und Spitalverhältnisse
Das Kaiserwaldspital war das Sammelspital für eine ganze Reihe von Lagern. Mühlgraben, Straßenhof, Lenta, Jungfernhof schickten alle ihre Kranken zu uns ins Lazarett. Da ich selbst im Spital arbeitete, habe ich alles miterlebt. Die Sterblichkeitsziffer im Kaiserwaldspital war sehr hoch, besonders als bei uns eine Typhusepidemie ausbrach. Unser Chefarzt war der SS-Oberscharführer Wiesener, ihm überstand der Lagerarzt SS-Sturmbannführer Dr. Krebsbach. Beide waren typische Naziärzte. Man überließ uns, d.h. den Häftlingen, die als Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter tätig waren, die Verantwortung für das Lazarett. Aus allen Lagern kamen die fast zu Skeletten abgemagerten Kranken zu uns. Obwohl wir taten, was wir konnten, auch Lebensmittel von allen Häftlingen sammelten oder aus der SS-Küche organisierten, gelang es uns oft nicht, die Kranken am Leben /u erhalten, da auch für diese nur die allgemeine Lagerration zur Verfügung stand. Wie in fast allen Lagern, herrschte auch bei uns die Dysenterie, die Hauptkrankheit der Häftlinge. Diese Krankheit richtete erschreckende Verheerungen an. Über und über beschmutzt und zum Skelett abgemagert sah man sie gleich Gespenstern durchs Lager schleichen, immer und immer wieder den einen Weg zur Latrine, eingehüllt in ihre graue Schlafdecke.
Die Spitalverhältnisse im Lager waren so, daß die meisten eine wahnsinnige Angst hatten, eingeliefert zu werden, nicht wegen Pflege und Behandlung dort, sondern wegen der Aktionen, denen diejenigen, die nicht schnell genug gesund wurden, ausgeliefert waren. - Die SS verlangte von den Häftlingen, die Sanitätsdienst machen mußten, unnachsichtige Befolgung sämtlicher Befehle. Wir hatten zwar zu allem ja gesagt, haben aber doch, soweit wir konnten, das getan, was wir für richtig hielten. Kein Patient durfte länger als 21 Tage im Spital liegen. Der 21. Tag war der Stichtag zur Meldung auf der Kommandantur.
Selbstverständlich machte von uns Häftlingen keiner Meldung, aber die SS hielt Kontrollen ab und schrieb selbst die Kranken auf, deren Zeit abgelaufen war. Oftmals bekamen wir für unser eigenmächtiges Handeln "Fünfundzwanzig"; aber an die Schläge waren wir schon gewöhnt, und es gelang uns, manchen Kranken den Fängen der SS-Mörder zu entreißen. Auch unser Los war nicht leicht, wenn wir auch nicht die schwere Arbeit draußen bei Wind und Wetter zu leisten hatten, aber Nerven erforderte unsere Arbeit in hohem Maße. Wieviel Zerschlagene und Moribunde kamen zu uns, bei denen uns nur noch die Möglichkeit blieb, ihnen die letzten Tage ein wenig zu erleichtern. So waren zum Beispiel alle Kranken, die uns vom Lager Straßenhof überwiesen wurden, Todeskandidaten.
Nur derjenige, der täglich selbst diese Dinge ansehen und mitmachen mußte, weiß, was wir empfanden, wenn die Augen der eingelieferten Todeskandidaten uns anblickten und anbettelten um ihr armseliges Stückchen Leben. Das Sanitätspersonal wurde von der SS strengstens überwacht, ob es bei den Kranken, den Stichtag inne hielt. Rücksichtslos wurden wir wegen jeder kleinen Verfehlung geschlagen, so z.B., wenn bei einem Kranken die Decke ein wenig verrutscht war oder nicht ganz glatt lag. Zumeist erfolgte die Bestrafung öffentlich beim Appell. Sehr häufig haben wir das Einlieferungsdatum der Kranken geändert, denn der SS waren die Häftlinge viel zu gleichgültig, als daß sie sich genauer angesehen hätten, und so gelang es uns oft, Menschen zu retten. Sehr häufig waren Aktionen. Dann wurden die Lazarette vollständig ausgeräumt. Wohin man die Kranken brachte, wissen wir nicht, nur daß nie wieder einer zurückgekehrt ist. Himmelsfahrtskommandos nannte man die Aktionen, durch die Kranke und Schwache aus dem Lager entfernt wurden.
Unter anderem will ich nur über das Schicksal der beiden bildhübschen Schwestern Annemarie und Margit Zorek aus Gelsenkirchen berichten. Sie waren bereits vom Typhus geheilt, warteten im Lazarett nur auf ihre letzte Blutprobe, als auch sie für die Aktion aufgeschrieben wurden. Sie haben furchtbar geweint und geschrien, da sie nicht sterben wollten. Ich habe sie im Lager einen halben Tag versteckt gehalten, doch dann entdeckte sie ein SS-Mann, und sie wurden, da die anderen schon abtransportiert waren, mit einem besonderen Auto fortgebracht, wohin, das weiß keiner.
Todesarten wie Erschießen und Erhängen waren bei uns etwas Alltägliches, das Totschlagen auch, aber gegen Ende des Jahres 1943 tauchte eine neue Todesart auf, die ein besonders findiger Sadist ausgeklügelt hatte, das Ertränken von Häftlingen in der Latrine, eine der schrecklichsten Quälereien, die nur als Ausgeburt einer Höllenphantasie bezeichnet werden kann. Die ausführenden Organe waren die Schwerverbrecher und kriminellen Zuhälter aus deutschen und lettischen Zuchthäusern. Kasernierungen waren an der Tagesordnung. Handelte es sich um jüngere Menschen und Facharbeiter, konnte man damit rechnen, daß sie vorläufig noch am Leben blieben, wurden aber Alte, Schwache und Kranke genommen, wußte schon jeder, was los war.
Am 2. November 1943 fand bei uns die erste Kinderaktion statt, der alle Kinder bis zu zwölf Jahren zum Opfer fielen. Sie wurden bei bitterster Kälte in offene Waggons verladen, angeblich sollten sie in ein deutsches Kinderheim geschickt werden. Wir fragen heute mit Recht: Was geschah mit diesen Kindern? Stimmt es, was die lettischen Eisenbahner uns später erzählten, daß man die Züge mit Kindern, Alten, Schwachen und Kranken auf Nebenstrecken hin- und hergefahren habe, selbstverständlich bei geschlossenen Waggontüren, bis alle verhungert und erfroren waren? Wir haben nie wieder etwas von diesen Kindern gehört, auch nicht von den letzten, damals noch übriggebliebenen Kindern der östlichen Lager, die in einem Sammeltransport am 12. März 1944 vom Kaiserwald wegbefördert wurden. Außerdem war am gleichen Tage eine andere Aktion gegen die älteren Leute aus den verschiedenen Lagern, die am Abend im Lager Kaiserwald eintrafen, die ganze Nacht auf dem Appellplatz zubrachten und am Morgen, zusammen mit denen, die in unserem Lager ausgesucht worden waren, abtransportiert wurden, wie immer mit unbekanntem Ziel.
Stützpunktkommandos
Ließ sich einer der Lagerinsassen in den östlichen Lagern etwas zuschulden kommen, und man wollte seine Arbeitskraft noch ausnutzen, ehe man ihn umbrachte, so wurde er von der SS auf sogenannten Stützpunktkommandos verschickt. Es handelte sich bei solchen Kommandos um Aufräumungsarbei-ten in Frontnähe und um Minensuchen usw. Sehr viele Frauen und Männer wurden verschickt, die dann nach Beendigung dieser Arbeiten umgebracht wurden. Nie kam von einem dieser Menschen ein Lebenszeichen ins Lager. Alles im Lager war auf Bestialität aufgebaut. Starb im Revier ein Häftling, mußte selbstverständlich die Kommandantur sofort benachrichtigt werden, und schon nach wenigen Minuten erschien ein besonderer Zahntechniker der SS, der vorhandene Goldzähne und -brücken den noch warmen Leichen ausbrach. Das Grauen überkam mich manchmal bei all dem, was sich zutrug. War ein Mensch gestorben, so wurden die nackten Leichen an Händen und Füßen angefaßt und wie ein Sack aus der Baracke getragen, in einen leeren Schweinestall geworfen, so lange, bis eine Autoladung zusammen war, und dann transportierte man sie ab, zur Verbrennung oder zum Verscharren im Massengrab. Nicht einmal einen Papiersack stelllte die SS zur Verfügung, um die Blöße der Leichen zu bedecken.
Ein Kapitel für sich waren auch die Untersuchungen, wenn neue Transporte ankamen. Sehr gut sind mir noch die Transporte aus den Ghettos Kowno, Schaulen und Wilna in Erinnerung. Diese Männer und Frauen hatten noch viel Geld und kostbaren Schmuck bei sich, da bei ihnen die Gestapo beim Abtransport aus dem Ghetto noch keine Leibesvisitation gemacht hatte. Wo bei den Männern Geld gefunden wurde, sind sie von der SS und ihren Helfern zumeist fürchterlich mißhandelt worden, ja manche wurden direkt totgeschlagen. Bei den Frauen machte man sogar gynäkologische Untersuchungen, die ein jüdischer Häftlingsarzt in Gegenwart der SS und der Kapos vornehmen mußte. Fand man bei dieser Untersuchung etwas, gab es für die Frauen unnachsichtig 25 Hiebe. Alle Zivilkleidung wurde weggenommen und die wohl jedem bekannte "Zebratracht" angezogen. Beim Ausziehen, beim Baden, beim Anziehen, immer wurde geschlagen. Zu all diesem kamen noch die seelischen Leiden, die die Ankommenden viel stärker empfanden als wir, die wir schon im Laufe der Zeit abgestumpft waren. Ich vergaß noch zu schreiben, daß man zu dieser Zeit schon den Frauen das Haar mit der Millimetermaschine rasierte, wohingegen bei den Männern das Haar ungehemmt wachsen konnte bis auf eine "Avusbahn", die in Maschinenbreite von der Stirn bis zum Nackenwirbel ausrasiert wurde, so daß die Männer wie Struwelpeter aussahen.
In der letzten Zeit gab es im Lager Kaiserwald schon häufiger Fliegeralarm. Dann wurden wir in unsere Baracken eingeschlossen, obwohl das Tanklager der deutschen Luftwaffe kaum 200 Meter vom Lager entfernt war. Ebenso schloß man uns beim Brand der Kleiderkammer in die Baracken ein, und wir durften die Baracken erst verlassen, nachdem der Dachstuhl der beiden nächstliegenden Männerbaracken schon lichterloh brannte. Beim ersten großen Bombenangriff auf Riga verloren sehr viele der Eingeschlossenen die Nerven, so daß das Weinen und Schreien draußen zu hören war. Nachdem der Alarm beendet war, hagelte es von der SS dafür Prügelstrafen.
Als die Front immer näher rückte, gab es erneut Appelle, Aussortierungen der Fußkranken und Schwachen. Zu den bei uns Ausgesuchten kamen die Transporte aus den anderen Lagern, und wieder wurden eine Unzahl Menschen ins Ungewisse verschickt. Dann erfolgte die Zusammenstellung eines großen Transportes für das Höllenlager Stutthof bei Danzig, mit dem auch ich verschickt wurde. Damals wußten wir allerdings noch nicht, wohin wir kamen. Man hatte uns nur gesagt, daß wir zur Arbeit nach Deutschland transportiert würden. Auf dem Schiff traf ich dann zufällig meine Mutter, von der ich fast zwei Jahre getrennt war. Alles in allem kann ich wohl sagen, daß durch Todesurteile, Himmelfahrtskommandos, Aktionen und infolge der schlechten Verpflegung und Behandlung in Riga über 10.000 Menschen zu Tode gekommen sind.
Die Aktion vom 10. Oktober 1943
Am 10. Oktober 1943 war das ganze Ghetto schon um 4 Uhr morgens von SS mit Maschinengewehren umstellt worden. Nur die Arbeitskommandos durften das Ghetto verlassen. Am Tore des Ghettos hatte außer unserem Ghettokommandanten mit seinem Stab auch der berüchtigte Major Lange sich eingefunden. Als wir den Bluthund von Lettland (so nannte man Dr. Lange) sahen, verließ uns alle Hoffnung. Wir wußten schon, daß wieder eine Mordaktion durchgeführt werden sollte, nur, wen es dieses Mal treffen würde, war uns noch nicht klar. Traf es dieses Mal die lettischen Juden, deren Lager uns gegenüber lag, oder unsere Angehörigen? Es sickerte schon durch, daß an dem Abend vorher 40 der jüngsten, hübschesten und intelligentesten Männer des lettischen Ghettos zur Kommandantur geholt worden waren und daß alle lettischen Männer halb ausgezogen, so wie man sie aus den Betten geholt hatte, mit erhobenen Händen unter dem Schutze von SS-Posten vor ihren Wohnungen standen.
Angeblich sollten im lettischen Ghetto vergraben Waffen gefunden worden sein. Viele lettische Männer wurden an diesem Morgen im Ghetto zurückbehalten. Die Arbeitskommandos traten totenbleich und zitternd vor Erregung den Weg zur Arbeit an, wußte man doch nicht, welches Unheil sich wieder über uns zusammenzog. Als wir nach zwölf Stunden entsetzlicher innerer Qual zurückkamen, lag das Ghetto totenstill. Auf dem Blechplatz, dem Appell- und Sammelplatz des Ghettos, hatte die SS diese 40 jungen Juden mit Kolbenschlägen und Gummiknüppeln ins Maschinengewehrfeuer getrieben.
Viele von ihnen setzten sich mit nackten Fäusten gegen die bewaffnete SS zur Wehr, besonders die Obleute der jüdischen Ghettopolizei, Iska Back, Tolja Nathan und Boris Lifschitz. Diese drei haben noch eine Reihe von SS-Leuten zu Boden geschlagen, bis sie selbst, von vielen Kugeln durchbohrt, zu Boden sanken. Die Männer, die später das Massengrab für die 40 Opfer schaufeln mußten, erzählten uns, daß mehrere der Jungen wie Siebe von Maschinengewehrkugeln durchlöschert gewesen seien. Die von der SS bei dieser Aktion gemachten Aufnahmen erschienen unter dem Leitspruch in Deutschland "So schlägt die SS einen Aufstand im Ghetto nieder".
Die Angst des körperlich kleinen, mickerigen Kommandanten Karl Wilhelm Krause ließ ihn am hellen Tage Gespenster sehen, und nur aus Anlaß seines Verfolgungswahns mußten auch diese 40 jungen Männer sterben. Einem von ihnen gelang es noch, dem Blutbad verwundet zu entrinnen. Man suchte ihn, und der Kommandant selbst stellte ihn an einer entlegenen Stelle des Ghettos. Tolja Nathan, denn um diesen handelte es sich, rief ihm zu: "Du Hund, du kannst mich erschießen, aber vorher will ich dir sagen, was ich von dir denke. Du Feigling, du bist das größte Schwein auf Gottes Erdboden. Du nahmst alle unsere Frauen und Mädchen, die dir gefielen, für dich, hast Hunderte von Menschen eigenhändig umgebracht, und am Gut dieser ermordeten Juden hast du dich bereichert. Auch mein Mädchen hast du mir mit Gewalt genommen, und ich weiß nicht, wo sie ist, vielleicht hast du auch sie schon umgebracht. Aber heute sage ich dir, du wirst elend zugrunde gehen und mit dir die ganze verlogene und verfaulte Nazidiktatur. So, nun kannst du mich erschießen."
Der Kommandant stand grünbleich, zur Salzsäule erstarrt. Plötzlich aber verzerrt sich sein Gesicht vor Wut. Er schoß wie ein Wahnsinniger auf den Wehrlosen, schon Verwundeten, der schließlich, von 32 Schüssen durchbohrt, blutüberströmt, leblos zusammenbrach. Hunderte von lettischen Bürgern haben das mit angesehen, was es sich an der Straße, am Zaun des Ghettos abspielte. Auch sie hat das Entsetzen vor soviel Brutalität gepackt. Von ihnen haben wir später Bericht über dieses Ereignis bekommen. Wutgeladen über diese moralische Niederlage beschloß die SS, Geiseln zu nehmen, und so wurden noch ungefähr 350 Menschen als Geiseln ins Zentralgefängnis gebracht. Von ihnen hörte man nie wieder etwas. Noch war die seelische Depression nicht von uns gewichen, da kam als letzter Vorbote für die Auflösung des Ghettos die Aktion vom 2. November 1943. Einige Kommandos gingen noch hinaus zur Arbeit. Alle anderen waren schon aufgelöst worden. Um 6.45 Uhr kam der Befehl der Kommandantur: "Alle Kinder bis zu zwölf Jahren haben sich um 7:45 Uhr auf dem Blechplatz einzufinden. Warme Kleidung und eine Decke sind mitzugeben." Ein panischer Schrecken erfaßte die Mütter. Alles hatten sie geduldig ertragen, Hunger, Kälte und Schläge. Die Männer waren ihnen zum Teil ermordet worden, zum Teil gestorben oder verschleppt, ältere Kinder in andere Lager verschleppt, und nun sollten sie auch noch die kleinen hergeben. Manche sind damals am Rande des Wahnsinns gewesen. Nichts half, die SS verlangte die Kinder.
Auch ich hatte ein kleines, goldblondes, entzückendes Mädel angenommen als es 16 Monate alt war. Der Vater des Kindes war in Salas Pils gestorben, und die Mutter hatte den Verstand verloren. Es war gerade im Oktober drei Jahre alt geworden. Ich selbst mußte das aufgeweckte Kind zum Blechplatz bringen, dem Ort, von dem das Blut des 10. Oktober noch nicht weggewaschen war. Mit seinem Täschchen in der Hand ging es totenbleich neben mir her und sagte immer: "Mutti, du gehst doch mit?" Das Herz blutete mir, wußten wir doch, was den Kindern blühte. Inzwischen war der Blechplatz schon voller Kinder, die alle wußten, daß sie einem schrecklichen Schicksal entgegengingen. Mütter und Großmütter flehten die SS an, die Kinder begleiten zu dürfen, und soweit es sich nicht um Facharbeiterinnen handelte, wurde den leiblichen Müttern gestattet, mitzugehen.
Inzwischen durchsuchte die SS die Häuser, und alle älteren und schwächeren Menschen wurden zum Blechplatz gebracht. Das Lazarett wurde aufgelöst, die Schwerkranken mit Bahren auf die Lastautos geschoben, darunter auch solche mit ganz frischen schweren Operationen. Eine Frau ist entlaufen, die Klammern von einer schweren Unterleibsoperation noch in der Wunde. Vor dieser Aktion rettete sie sich, um einige Wochen später an einer Sepsis zugrunde zu gehen. Schrecken erfaßte das ganze Ghetto. Die Schreie der Frauen und Kinder klangen schauerlich, dazwischen das Brüllen und Schlagen der SS. Es war furchtbar! Endlich hatte man die armen kleinen Würmer verfrachtet und mit den Alten, Schwachen und Kranken in einen langen Zug auf dem Bahnhof Shirotawa verladen; in Güterwagen ohne Stroh, nur mit Brotverpflegung, bei 32 Grad Kälte. Man hatte so viele Menschen ausgesucht, daß schließlich nur noch etwa 1.200 Menschen, größtenteils Facharbeiter, übrigblieben, die in einem Lager "Armeebekleidung" kaserniert werden sollten. Als wir, ein trauriges Häuflein, in unsere Wohnungen zurückgingen, hatte deutsche und lettische SS dieselben vollständig durchwühlt und zum Teil sogar ausgeplündert. Totenstill war das Ghetto geworden, jegliches Kinderlachen war verstummt. Was aus den Verschleppten geworden ist, weiß niemand; es waren über 2.500.
Armeebekleidungslager Mühlgraben
Einige Tage später mußten die noch im Ghetto Verbliebenen mit Gepäck auf dem Blechplatz antreten zur Verfrachtung nach Mühlgraben. Wir stiegen in die Lastautos, und man fuhr uns ins Konzentrationslager Kaiserwald zur Kontrolle. Dort wurden wir registriert, erhielten Häftlingsnummern, Sterne vorn und hinten hatten wir ja schon seit Jahren. Alles, was noch gut war an Wäsche und Kleidung, wurde uns abgenommen. Als Beigabe erhielten wir dann noch Schläge und Püffe. Ich selbst hatte an der rechten Hand eine Blutvergiftung, fast 40 Grad Fieber, und konnte kaum die Schmerzen ertragen. Da sahen wir unsere Männer auf der gegenüberliegenden Seite stehen, und ich sah, wie ein Mann von einem der Verbrecher dreimal zu Boden geschlagen wurde. Mit einem Male empfand ich, "dein Mann wird dort geschlagen". Schon wurde ich zur Kontrolle in die Baracke geschoben. Ich erhielt einen Schlag ins Gesicht, aber ich spürte nichts, ich war wie betäubt. Unsere Koffer waren schon vorher mit Lastautos zum Mühlgraben geschafft worden, und nachdem wir registriert waren, freuten wir uns auf die warmen Kleidungs- und Wäschestücke, die wir in Sicherheit glaubten. Wir kamen spät am Abend müde vom Kaiserwald zum Mühlgraben. Todmüde sanken wir auf unsere Strohsäcke.
Unser Erwachen war ein großer Schrecken. Mühlgraben war nichts anderes als eine Filiale vom Kaiserwald, und auch dort erhielten wir unsere Koffer nicht zurück. Der Lagerälteste, die Lagerpolizei, im Innendienst beschäftigte Kolonnenführer und -führerinnen, vor allem aber der SS-Kommandant Unteroffizier Müller, ein Friseur aus Mülheim (Ruhr), und sein Helfer Saß waren die Nutznießer der aus dem Inhalt unserer Koffer errichteten Kleiderkammer. Vom Mühlgraben aus wurden wir den verschiedenen Abteilungen des Armeebekleidungsamts zur Arbeit zugeteilt. Schon unsere Einteilung vollzog sich in der gleichen Art, wie wir sie im Kaiserwald gesehen hatten. Ich wurde der Kolonne "Infanteriekaserne" als Schneiderin zugeteilt. Der Weg vom Mühlgraben zur Infanteriekaserne betrug ungefähr drei Stunden. Interessant, wie wir den Weg machten. 500 Menschen wurden in einen Zementkahn verladen wie das liebe Vieh. Aufeinandergedrängt fuhren wir stehend drei Stunden, kamen vollständig verklammt an der Arbeitsstelle an, so daß wir oft für die ersten Stunden nicht arbeiten konnten. Abends diesselbe Beförderung. Oft war es 10 Uhr, bis wir ins Lager zurückkamen. Dann mußten wir unsere Suppe und unser Brot holen, so daß es meist 12 Uhr nachts war, bis wir ins Bett kamen, und schon um 4 Uhr am Morgen wurden wir wieder geweckt.
Nun etwas zum Lager selbst. Im Mühlgraben war früher ein Fabrikgebäude der IG-Farben, in dem Ultramarin hergestellt wurde. Alles war dort blau und dunstig. Frauen und Männer waren zwar getrennt untergebracht, jedoch war es den Frauen öfter möglich, zu den Männern zu kommen. Die Todesstrafe schreckte uns nicht. Dieses Lager war trotz des schlechten Essens noch erträglich, da die Frauen doch Gelegenheit hatten, ihre Männer zu sehen. Als der Winter mit Eis und Schnee kam, wurden wir mit dem Güterzug zur Arbeit befördert. Oft lag der Zug morgens stundenlang auf der Strecke. Abends mußten wir auch fast immer einige Stunden auf freiem Felde auf den für uns bestimmten Güterzug warten. Viele erkrankten infolge von Kälte und Nässe, jedoch durfte man erst bei über 38,5 Grad Fieber im Lager bleiben, und so wurden viele Krankheiten so lange verschleppt, bis sie chronisch wurden. Tage der Aufregung folgten bald der trügerischen Ruhe. Unser Mühlgraben war Auffanglager für Heeresgut aus dem Osten. Waggons voll blutiger und zerrissener Heeresbekleidung kam aus dem Felde zurück, die von uns gereinigt und wieder verarbeitet werden mußten.
Die Unmenge blutiger Uniformen sagte uns, daß der Krieg mit der UdSSR nie gewonnen werden konnte, trotz aller Siegesmeldungen. Unsere Herzen begannen langsam zu hoffen. Je weiter der Krieg mit der UdSSR fortschritt, um so nervöser wurden unsere Peiniger. Nacheinander wurden die Leiter der Armeebekleidungsstellen und Werkstätten, Wehrmachtsangehörige, die menschlich zu uns Häftlingen waren, abgelöst, von Parteigenossen, die sich im Sinne Hitlers, Goebbels' und Himmlers zu den KZ-Häftlingen einstellten. Eine Kommandokontrolle jagte die andere, so daß es fast unmöglich war, sich zu der kargen KZ-Ration noch etwas hinzu zu besorgen. Unruhe ergriff die Insassen des Lagers. Die Krankheitsfälle mehrten sich. Wer längere Zeit krank war, wurde ins Stammlager Kaiserwald gebracht, zumeist auf Nimmerwiedersehen. Zu unserem Lager gehörten noch ungefähr 25 Kinder, die man seinerzeit bei der Aktion vom 2. November versteckt hatte. Wir alle waren glücklich über das Kinderlachen, obwohl viele von uns die eigenen Kinder verloren hatten. Eines Abends, als wir von den Kommandos zurückkamen, waren sämtliche Kinder unter 14 Jahren, auch die, die bereits zur Arbeit herangezogen worden waren, von der SS abgeholt worden.
Inzwischen hatten sich die Nazikulturträger der Hitler, Himmler, Goebbels und Konsorten eine neue Grausamkeit im Ghetto ausgedacht. Sei es, daß der Anblick unserer Frauen und Mädchen das Sexualbedürfnis der überfütterten SS zu stark erregte, oder wollte man, wie man immer sagte, uns „Parasiten" kenntlich machen? Kurzum, allen jüdischen Frauen wurde genau wie im Kaiserwald das Kopfhaar mit der Millimeterschere abgeschnitten. Die Köpfe sahen aus wie rasiert, wir schüttelten uns vor Grauen, wenn eine die andere ansah, wir erkannten einander nicht mehr, so entstellt waren wir.
Ein schwarzer Sonntag im Mühlgraben
Der Kommandant hatte befohlen: "Keiner darf das Gebäude verlassen, eine Strafaktion wird durchgeführt." "In der Gashalle hat sich etwas zugetragen", so tuschelte man einander zu. Schon sahen wir die Opfer kommen. Sie gingen je zu zweit und hatten ein großes Brett, das mit etwa zwei Zentner schweren Holzstämmen beladen war, um den Hals hängen. Dieses mußte 200 bis 250 Meter weiter getragen werden, und zwar im Galopp (es war Sommer, etwa 30 Grad Hitze). Der Kommandant und zwei Helfer trieben mit Gummiknüppeln die Leute an, es waren im ganzen 19 Männer und eine Frau. So mußten drei Waggons Holz ausgeladen werden.
Nach kurzer Zeit schon brachen die Opfer zusammen. Sie wurden mit Fußtritten traktiert und mit kaltem Wasser begossen, bis sie wieder aufstanden. Auf die Frau Käthe Ehrlich, eine schöne, große blonde Wienerin, hatte es der Kommandant besonders abgesehen. Er prügelte und trieb sie so lange, bis sie blutend zusammenbrach, und dann schlug er noch weiter auf sie ein, bis Arzt und Krankenschwester hinzukamen und die Unglückliche ins Lazarett brachten. Ein Wiener Philologe, dessen Name mir entfallen ist, der eine angegriffene Lunge hatte, bekam einen Blutsturz und brach ebenfalls zusammen. Auch er wurde noch getreten und geschlagen, als er bereits am Boden lag. Er ist später in einem anderen Lager an Körperschwäche zugrunde gegangen. Alle 29 Delinquenten wurden lazarettfähig geschlagen. Als Grund wurde angegeben, es sei Wehrmachteigentum aus der Gashalle entwendet worden, und da man den Täter nicht fand, statuierte man ein Exempel an den Arbeitern der Gashalle. An einem Morgen, als samtliche Kommandos zur Arbeit herausgehen wollten, wurde ausgemustert. Etwa 200 Menschen wurden ausgesucht und in ein Armeebekleidungsamt angeblich nach Deutschland geschickt. Der Name des Lagers ist mir auch entfallen, aber es war in Westpreußen. Später trafen wir einen Teil der Menschen in Stutthof wieder.
Eine Ärztekommission ist im Lager
Unsere Männer standen vollständig nackt auf dem Hofe. Solche, die körperlich nicht auf der Höhe waren oder einen Bruch hatten, wurden herausgesucht und sofort auf Lastwagen verladen. Dann kamen wir Frauen an die Reihe. Auch von uns wurden alle, die irgendwie alt und schwach aussahen, aussortiert und auf Nimmerwiedersehen verschickt. Wir hörten später, daß diese Aktion in allen Lagern, die dem Kaiserwald unterstanden, durchgeführt worden war.
Inzwischen war ein großes Pelzlager der Armeebekleidung durch Feuer zerstört worden. Pelze, im Werte von Millionen, die aus Rußland als sogenannte Kriegsbeute angekommen waren, fielen dem Feuer zum Opfer. Ich vergaß zu bemerken, daß alle höheren Angestellten der SS und Armeebekleidung kostbare Pelzmäntel für sich und ihre Angehörigen aus diesen Beständen anfertigen ließen und nach Deutschland schickten. Als der Mühlgrabenkommandant auf Urlaub nach Mülheim an der Ruhr fuhr, nahm er nur acht große Koffer mit. Seidene Oberhemden für sich, seidene Wäsche, Hüfthalter und Büstenhalter für die Frau. Kleider für die Frau wurden in unseren Werkstätten massenhaft hergestellt oder verändert. Alles aus den beschlagnahmten Koffern der deutschen und lettischen Juden. Ebenso nahm er Uhren, Schmucksachen, Füllfederhalter und Sonstiges mit nach Hause. Dieser Unteroffizier, der doch nur ein kleiner Friseur in seiner Heimat gewesen war, bekam genau so den Größenwahn wie der Kommendant des Ghettos, Karl Wilhelm Krause. Größenwahn war eine typisch nationalsozialistische Krankheit, deren Hauptbazillenträger Hitler und sein Adlatus Goebbels waren.
Jeden Sonnabend nach Rückkehr der Arbeitskommandos ins Lager fand eine Häftlingszählung statt. Wehe, wenn einer entflohen war. Dann gab es drakonische Strafen, meistens Schmälerung der an und für sich schon kargen Lebensmittelration und Verschickung von Geiseln in den Kaiserwald. Ein schreckliches Wort in unseren Ohren war auch die Verschickung nach sogenannten Stützpunktkommandos. Wir hielten diese Kommandos für Himmelfahrtskommandos, weil nie einer von dort zurückkam. "Sonntag wird frei sein, es findet keine Zählung statt!" So hieß es an einem Sonnabendabend. Einen freien Sonntag! Wir waren glücklich, bis 7 Uhr schlafen zu können, war doch an jedem Morgen schon um 4 Uhr Wecken, um 5 Uhr Antreten zum Kommando.
Am nächsten Morgen wurden wir um 6 Uhr geweckt. Alles wurde von der Polizei herausgetrieben. Die Nachdenklichen sagten „Verschickung", zogen sich noch an und nahmen das Nötigste mit. Die Sorglosen sagten "nur Zählung" und hängten sich nur den Mantel um. Zu den ersteren gehörte auch ich, ich hatte mir schon lange vorher eine große Umhängetasche aus Zeltbahnstoff gemacht, in dieser nahm ich meine Habe mit. Als wir draußen SS sahen, wußten wir genug. Inzwischen wurden die Männernamen verlesen. Die Aufgerufenen mußten sich gesondert aufstellen. Nach den Männern kamen die Frauen an die Reihe. Ich gehörte zu denen, die nicht mit aufgerufen waren. Mein Mann war dabei, und ich bat den Kommandanten, mich doch auch mitzunehmen. Nach langem Bitten tauschte er mich gegen ein junges Mädchen aus, das gern bei seiner Tante bleiben wollte. Man führte die Ausgesuchten in die Gashalle, Schwerverbrecher und Dirnen aus dem Kaiserwald nahmen uns alles ab, was wir bei uns hatten. Mäntel und Oberkleider mußten wir auch ablegen und erhielten dafür neue blaugraugestreifte Sträflingstracht, die später mit unserer Häftlingsnummer versehen wurde. Ich erhielt die Nummer 51566.
Unsere Männer waren gefilzt, umgekleidet und inzwischen schon in ein Schiff verladen worden. Wir erhielten, ebenso wie sie, für drei Tage Lagerverpflegung und wurden auf dasselbe Schiff verladen; wir vorn im Schiff, die Männer hinten. Einander zu sehen und zu sprechen, war unmöglich. Wir fuhren mit dem Schiff bis in die Rigaer Bucht, dort stand schon ein riesiges Schiff, in das wir verladen werden sollten. Wir sahen mehrere Dampfer an uns vorbeifahren, mit fast nur jungen Menschen besetzt, diese wurden außer von SS noch begleitet von den Lagerkapos, Lager- und Blockältesten. Einige dieser SS-Handlanger kannten wir schon und wußten dadurch, daß auch die Konzentrationslager Kaiserwald und Straßenhof ihre Leute verschickten. Ich hatte jetzt eine leise Hoffnung, mein Kind zu finden, und als ich den berüchtigten Verbrecher X. fragte, ob beim Kaiserwaldtransport meine Tochter, die im Kaiserwaldlazarett tätig war, dabei sei, sagte er mir: "Nein". Traurig stieg ich in den untersten Raum des entsetzlich schmutzigen Schiffes, suchte mir ein Lager (eine Koje für drei bis vier Menschen) und legte mich hin.
Wie lange ich vor mich hingrübelnd gelegen hatte, weiß ich nicht, denn das Schiff fuhr schon. Plötzlich sprang ich wie elektrisiert aus der Koje. Die Stimme war die meiner Tochter, und als ich nach ihr suchte, sah ich sie im weißen Kittel die Schiffstreppe herunterkommen. Sprechen konnten wir beide nicht, wir hielten uns nur fest umschlungen nach über zweijähriger Trennung. Nun war mir leichter, hatte ich doch ein Kind von dreien wieder. Wir fuhren vier Tage auf dem Dampfer, aufeinandergepfercht wie die Heringe, im Herzen die bange Frage: Was wird nun kommen? Man hatte uns zwar im Mühlgraben gesagt, daß wir mit unseren Männern gemeinsam zur Arbeit nach Deutschland geschickt würden, aber die SS hatte uns schon oft belogen. Endlich fuhren wir in die Danziger Bucht ein, wo wir ausgeladen wurden. Jetzt würden wir endlich unsere Männer sehen, die auf der Fahrt, ebenso von SS bewacht wie wir, in einem anderen Teil des Schiffes gelegen hatten. Auf einer großen Wiese durften wir uns hinlegen, rechts die Frauen, links die Männer, selbstverständlich wieder bewacht von SS, die durch Püffe und Schläge jegliche Annäherung verhindern sollte. Trotz allem fand man ein paar Sekunden, ein liebes Wort auszutauschen, einen Trost auszusprechen. Unsere Männer sahen in der Sträflingstracht entsetzlich aus mit den flachen, schirmlosen weißblauen Mützen.
Abtransport zum Vernichtungslager Stutthof
Man verteilte den Rest der vom Lager mitgenommenen Verpflegung, und dann wurden wir in geschlossene Schleppkähne verladen, die sonst für Kohlen, Kalk, Zement oder Steine gebraucht wurden. Dieses Verladen bedeutete eine unsägliche Grausamkeit. Die Luken wurden geöffnet, die SS trieb uns in die Kähne hinein, zwei bis drei Meter tief in den Laderaum, ohne Licht und ohne Luft. Viele sind bei dem schrecklichen Antreiben zur Eile von den Leitern gefallen, und alles spielte sich ohne einen Laut ab, denn beim geringsten Wort gab es gleich Schläge von der SS. Die Kähne wurden so voll gepfropft, daß man kaum stehen konnte. Es war Juli und zum Ersticken heiß. So fuhren wir ohne Licht und Luft vom Abend bis zum frühen Morgen. Später hörten wir, daß es den Männern noch schlimmer ergangen war.
Mehr tot als lebendig kamen wir an. SS empfing uns mit Geschrei und Schlägen, und dann ging es nach Stutthof, ein Weg von etwa zehn Kilometern. Als wir deutschen Juden die sauberen Häuschen in den kleinen Orten um Danzig sahen, glimmte schon wieder eine Hoffnung in unseren Herzen auf, wir raunten einander zu: "Jetzt sind wir in Deutschland, jetzt haben wir's vielleicht besser, vielleicht werden hier die Grausamkeiten aufhören. Man wird doch nicht wagen, vor den Augen deutscher Menschen KZ-Häftlinge wegen nichtiger Vergehen zu drangsalieren und zu ermorden."
Noch außerhalb des eigentlichen Lagers, dort, wo die Baracken noch im Bau begriffen waren, lagerten wir uns auf der Erde. Wir waren glücklich, daß wir uns waschen konnten, daß wir klares Trinkwasser hatten. Die Vorarbeiter, die wir dort trafen, waren sehr höflich zu uns, und so warteten wir voll Hoffnung darauf, unsere Männer zu sehen. Nach Stunden sahen wir den endlos langen Zug unserer Männer kommen. Wir freuten uns, wir wollten ihnen zuwinken, da wurden wir von SS-Posten vom Draht zurückgetrieben. Wir sahen unsere Männer nicht mehr, wir hörten nur die Schreie von Mißhandlungen in der Nacht. Wir waren in einem Steingerippe ohne Dach, ohne Fußboden, ohne Türen und Fenster untergebracht. Am folgenden Morgen wurden wir in das wirkliche Lager Stutthof gebracht. Hinter uns schloß sich das Tor einer Hölle.
Baracke 18a
Jede Baracke hatte zwei Teile, einen Teil a und einen b. Jeder dieser Teile war auf 250 Frauen berechnet. Die Blocks 18a und 18b erhielten eine Belegschaft von je 900 jüdischen Frauen. Selbst wenn vier Menschen in jeder Koje schliefen, reichte der Raum nicht aus, aufeinandergepackt lagen wir auf der Erde, den unbarmherzigen Schlägen und Stiefeltritten der Blockältesten ausgesetzt. Der Empfang mit Riemen- und Stockschlägen, Fußtritten und Ohrfeigen gab uns einen Vorgeschmack dessen, was uns erwartete. Vorbildliche Waschräume gab es und saubere moderne Toiletten, und wir freuten uns, daß wir uns wenigstens täglich duschen konnten. Aber die Waschräume und Toiletten wurden nur für ganz kurze Zeit geöffnet. Lenna, unsere Blockälteste, schlug, wir drängten uns in die Waschräume, denn jeder hatte Angst, Kleiderläuse zu bekommen. Kopfläuse kamen nicht an unseren geschorenen Köpfe.
Um 4 Uhr morgens war Appell. Zum Waschen war keine Zeit. Innerhalb drei Minuten mußte der Appell stehen. Ohne Schläge ging es nicht ab. Ein Häftling, namens Max Mosulf, der Henker vom Stutthof, hatte die Aufsicht über die Baracken der jüdischen Frauen. Er prügelte uns buchstäblich aus den Kojen heraus, hohnlachend und freudestrahlend, wenn seine Hiebe besonders gut gesessen hatten. Der Eingang der Baracke war außerordentlich schmal. 900 Frauen drängten heraus, teils aus Angst vor den Schlägen von M., teils aus Sorge, zu spät zum Appell zu kommen. In dieses Menschengedränge schlugen nun die beiden Blockältesten Sch. und L. noch mit ihren: Koppelriemen oder Stöcken ein, bis die Frauen schließlich durch die Barackenfenster hinaussprangen. Deutsche Jüdinnen waren diesen drei Spießgesellen besonders verhaßt.
Nach dem Appell, der oft stundenlang dauerte, gab es Kaffee und ein Stück Brot. In Zweierreihen mußten wir antreten, und je zwei erhielten zusammen eine Schüssel Kaffee. Beim Kaffeeholen gab es wieder Schläge, und wenn sich eine Frau aus Angst vor den Schlägen ungeschickt anstellte, wurde sie mit dem heißen Kaffee Übergossen. Kaum hatte man ein Plätzchen gefunden, um in Ruhe sein Brot zu essen, hieß es schon wieder: "Heraus, Appell stehen!" Appell stehen in glühender Sonne, ausrichten, unbeweglich stehen, nicht seine Notdurft verrichten können, denn die Toiletten waren am Tage verschlossen, so standen wir bis Mittag. Manche, die es nicht mehr aushielten, im glühenden Sonnenbrand zu stehen, setzten sich innerhalb der Zehnerreihen mal auf einen Moment, andere fielen ohnmächtig um. Mittags mußten wir uns wieder zu zweit aufstellen und erhielten wieder zu zweit eine Schüssel mit ungefähr einem Liter Suppe. Zumeist war es Kraut oder Grütze. Die Suppe war nicht so schlecht, es hätte nur mehr sein müssen, und man hätte uns Zeit zum Essen geben sollen. Kaum hatte man ein Plätzchen zum Essen gefunden und sich niedergelassen, da klatschte das Koppel schon wieder über Köpfe und Rücken.
Erneut prügelte man uns heraus. Das waren die ersten Tage. Für uns, die wir gewohnt waren, den ganzen Tag zu arbeiten, war dieses stundelange Appell stehen schrecklich. Endlich war die Qual zu Ende, wir durften in die Baracke und uns hinlegen, nachdem wir unsere Brotzuteilung und ein bißchen Margarine erhalten hatten. Nun kam wieder das Elend. Es war nicht Platz für alle. Man drückte und puffte sich auf dem Fußboden, eine trat der anderen mit den Füßen ins Gesicht, eine legte sich auf die andere, und an Schlaf war natürlich nicht zu denken. Kam es wirklich vor, daß man einschlief, wurde man sehr bald unsanft durch einen Stiefeltritt geweckt, auf den am Boden Liegenden wurde herumgetrampelt. Die in den Kojen zu dritt oder viert Liegenden wurden mit kaltem Wasser übergossen, das einige Frauen eimerweise heranschleppen mußten. Auch sonst war die Nacht über in der vorderen Baracke, wo unsere Blockältesten wohnten, reges Leben. Dort gingen die ganze Nacht Männer aus und ein.
Am zweiten Abend meldete ich mich zur Nachtwache, erstens: weil ich doch nicht schlafen konnte, und zweitens: weil es für die Nachtwache eine Sonderration Brot geben sollte. Es bewog mich noch ein Grund. Ich wollte das Lager richtig kennenlernen, hofften wir doch immer, es zu überleben. Wir waren ein kleiner Kreis sozialistisch denkender Frauen, die, so gut es ging, zusammenhielten. Wir wollten das Lager überleben, um der Nachwelt vor Augen zu führen, mit welcher Brutalität, ja Bestialität man im Dritten Reich regierte. In unserem Block waren wir nur sehr wenige deutsche Jüdinnen, von den anderen Blocks waren wir durch Stacheldraht getrennt. Es war verboten, mit den Insassen einer anderen Baracke zu sprechen, aber uns galten damals Verbote sehr wenig, und so erfuhren wir auch von den anderen KZ's und Torflagern von den Qualen unserer Mitschwestern. Überall war es das gleiche mit kleinen Nuancierungen. Hunger, Schläge, größenwahnsinnige Kommandanten, jüdische Kommandanten-und SS-Liebchen, größtenteils gezwungen, überall Verbrecher und Dirnen als Vorarbeiter und Vorgesetzte, überall die Anrede für uns "Ihr Judensäue!" und "Ihr Mistviecher!"
Ein paar Worte zur Charakterisierung von Max M., dem Henker des Stutthofs
Als am dritten Tag nach unserer Ankunft die SS mit den Blitzmädchen den Appell von sämtlichen Judenbaracken abnahm, sagte Max M. laut, so daß jeder von uns es hören konnte, zum SS-Kommandanten: "Ich verstehe nicht, warum man die Kohlen für die Judenschiffe gegeben hat, ich hätte mit viel weniger Kohlen die ganze Saubande im Krematorium verbrannt. Das wäre für mich ein Festtag gewesen." Als manche von uns entsetzt aufzuckten, meinte er: "Ich kann sie ja auch aufhängen, hübsch nebeneinander, wie die Krammetsvögel, na, Kommandant, wie war das, dann sind wir sie los?" Er war wirklich der Henker, an einem der nächsten Tage bekamen wir dafür den Beweis, als er 60 Männer nebeneinander aufhängte.
Es packte uns das Grauen, und wir alle, die wir noch ein Fünkchen Lebensmut in uns hatten, sagten uns: „Heraus aus dieser Hölle, ganz gleich wohin, nur fort von hier." Tagtäglich wurden Frauen und Männer beim Appell fürs Krematorium ausgemustert. Hatte eine Frau Ausschlag oder ähnliches im Gesicht, oder sah sie irgendwie nicht kräftig genug aus, so kam sie auf die andere Seite des Lagers in Baracke 8 oder 2. Wir selbst hatten in unseren Blocks kaum ältere Frauen, aber es waren riesige Frauentransporte aus Auschwitz gekommen, aus denen man täglich aussortierte. Tausende von ungarischen Jüdinnen kamen aus Auschwitz, zwar waren sie in Lumpen gehüllt, aber man sah unter ihnen bildschöne Gesichter und Körper. Im Duschraum sahen wir die herrlichen Gestalten der manchmal kaum 15jährigen. Beim Duschen war zumeist M. auch zugegen. Es war für uns furchtbar. Wollte man sich nicht schnell genug nackt ausziehen, begoß er uns mit Wasser oder schlug auf die nackten Körper. Einige bildschöne Ungarinnen bestellte er am Abend zu sich. Zu welchem Zweck, erfuhr ich erst in der Nachtwache. Mit einer ganz jungen Kölnerin, Edith Scherwonski, übernahm ich die erste Nachtwache. Über uns wölbte sich herrlich dunkelblau der gestirnte Himmel. Es war so friedlich um uns, daß für Minuten die Schrecken des Lagers verblaßten und wir leise eine wehmütige Melodie vor uns hinsummten.
Plötzlich sahen wir einige schattenhafte Gestalten in der gegenüberliegenden Baracke verschwinden, und zwar in der Baracke, wo der Vorgesetzte der Frauenblocks, M., am Tage ein Zimmer innehatte. In der Nacht war den Männern, mit Ausnahme der SS, der Zutritt ins Frauenlager verboten, jedoch konnte man in jeder Nacht die Kapos im Frauenlager bei ihren Liebchen antreffen, dieses waren zumeist ehemalige Dirnen, die bei uns Blockälteste waren. Wir mußten Wache stehen, damit nicht einer den anderen bei den Frauen überraschte, weil bei der Mentalität der Verbrecher die Folgen schrecklich gewesen wären. Immer haben wir gut aufgepaßt, aber in einer Nacht ist ein Mann durch das offene Fenster des Duschraums, der an der Rückseite der Baracke lag, ins Zimmer gegangen. Nun muß ich zum besseren Verständnis anführen, daß jede dieser "Damen" mehrere Liebhaber hatte, jeder Kapo mehrere Liebchen, jedoch der Lagerälteste, ein 27mal vorbestrafter deutscher Zuchthäusler, als dessen Heimatort in der Lagerkartei das Zuchthaus Herford angegeben war, hatte einen ganzen Harem von Blockältesten. Ich sehe ihn noch vor mir in jener Nacht, den "schönen Fritz" (wie er allgemein benannt wurde), in kurzer, schwarzseidener Hose, in einem blendendweißen Seidentrikot ohne Ärmel, muskelbepackt wie ein Athlet, mit einer anderthalb Meter langen Nilpferdpeitsche herumfuchtelnd.
"Na, is en Kerl drinnen", begrüßte er uns. Als wir ihm antworteten: "Nein", sagte er: "Morgen früh bekommt ihr eine doppelte Wachration und noch ein Stück Käse", und ging hinein. Eine Minute später hörten wir die Peitsche auf nackte Körper klatschen. Ein Geheul brach los, als ob alle Teufel der Hölle losgelassen seien, und dann rannte ein blutender nackter Mann aus der Baracke heraus. Um 3 Uhr morgens mußten wir Fritz wecken, denn um 4 Uhr begann das Leben im Lager. Das versprochene Brot und den Käse haben wir am Morgen wirklich bekommen.
Appell und Quälereien wechselten den Tag über einander ab. Nachtwachen hatten das Recht auf Schlaf am Tage, aber Max prügelte uns unbarmherzig aus den Kojen heraus. Noch über eine interessante Nacht will ich berichten, die dem Leser ein wenig Aufschluß geben soll, wes Geistes Kinder unsere Vorgesetzten waren. Wir mußten für L., die stets einen unheimlichen Durst hatte, Denaturat aus den Vorräten holen. Etwa zwei Liter Denaturat machten sie sinnlos betrunken. Dann lief sie splitternackt in der Baracke umher. Sie wollte zu Juro, die zweite Blockälteste, die auch ihre Liebste war, ins Bett. Sie schlug ununterbrochen mit einem Schemel gegen die Zimmertür von Sch., dabei die wüstesten Flüche und Schimpfworte ausstoßend. Alle Insassen der Baracke waren verängstigt und aufgeregt, und Sch. gab mir den Auftrag, Max zu holen. Max war gerade bei seiner Lieblingsbeschäftigung, sieben schöne, nackte Frauen mit der Reitgerte zu bearbeiten. Auch er war nackt. Selbstverständlich durften wir nichts sehen, sonst hätte er uns umgebracht. Max kam und schlug die L. derartig zusammen, daß sie blutüberströmt zusammenbrach. Durch all den Lärm war nun auch die SS geweckt worden, und in dieser Nacht erhielt die SS einen Einblick in die nächtliche Tätigkeit ihres Henkers Max.
Auf der einen Seite sollte und wollte er der Vernichter der Juden sein, auf der anderen Seite waren Jüdinnen die Objekte seiner Perversität. "Heute gibt es süßen Kaffee", raunte eine der anderen beim Appell zu. Alle freuten sich, doch nicht alle erhielten süßen Kaffee; meist nur ältere und schwach aussehende Frauen oder solche, auf deren Gesichtern Verzagtheit und Angst geschrieben standen. Nach dem Kaffee wurde es einigen schlecht, andere wankten. Man führte sie ab in die Lazarettbaracke. Am anderen Morgen ging wieder ein trauriger Zug vom Lager fort, der Seite zu, wo sich das Krematorium befand.
Eines Morgens befahlen L. und Sch., uns nackt auszuziehen, und was ihnen von unseren Sachen noch gefiel, nahmen sie, außer Gürteln, Kopftüchern und Schuhen. An einem Tage war ich durch Zufall mit noch einigen Frauen in den anderen Teil des Lagers herübergebracht worden. Zum ersten Male seit all den Jahren wurde ich schwach. Man hatte mich von meinem jüngst wiedergefundenen Kinde getrennt. Aber es wurde noch alles gut, mein Mädel suchte, bis sie mich fand, und am anderen Morgen kam ich zu ihr in die Kartei, wo sie schon einige Zeit arbeitete. Eines Nachmittags hieß es: "Heute nacht wird durchgearbeitet, und auch wir beide blieben auf dem Büro. Gegen 11 Uhr nachts erschien total betrunken Henker Max mit einigen Freunden in der Kartei und sagte zu seinen Kumpanen: "Hier habt ihr die Judensäue, nehmt euch davon, was ihr braucht." Dann wandte er sich zu uns mit Worten, wie wir sie noch nie im Leben gehört hatten. Totenbleich hörten wir seine Reden an und baten zwei Häftlinge vom Arbeitseinsatz, die bei uns arbeiteten, uns doch zu schützen. Als nach einiger Zeit noch ein deutscher Häftling erschien, der auch im Arbeitseinsatz arbeitete, gelang es ihnen schließlich zu dritt, Max zu entfernen.
Am nächsten Tage kam eine von Maxens Freundinnen in die Schreibstube, unterhielt sich mit uns und gab im Laufe der Unterhaltung meiner Tochter eine Zigarette. Alle wollten gern einmal ziehen, und so ging die Zigarette reihum. Als gerade eine junge lettische Frau den Rest der Zigarette in der Hand hielt, kam Max herein. Auf seine Frage, woher die Zigarette komme, sagte sie, von meiner Tochter. Max schrie darauf auf meine Tochter ein: "Du verfluchte Judensau, wo hast du die Zigarette her?" Nachdem meine Tochter ihm auf seine Frage keine Antwort gab, schrie er weiter: "Wenn du nicht sagst, woher du die Zigarette hast, wirst du aufgehängt." Mein Mädel schwieg, da sie niemand in Gefahr bringen wollte, kannten wir doch Max zur Genüge. Wutbebend gab er meiner Tochter eine Ohrfeige, daß sie taumelte. Noch vier Tage nachher konnte sie nichts hören. Dann sagte er: "Heute abend beim Appell meldest du dich bei mir, ich ziehe dir dann fünfundzwanzig auf. Du weißt, was das bedeutet, bei mir ist nach fünfundzwanzig noch keiner wieder aufgestanden. Na, hast du keine Angst?" Sie antwortete ihm nur kurz: "Nein".
Mir, als Mutter, krampfte sich das Herz zusammen, und die anderen, besonders die junge Lettin, waren tieftraurig. Langsam ging der Tag zur Neige. Zum Appell ging meine Tochter fort, und wir alle glaubten sie schon verloren. Nach ungefähr einer Stunde kam sie zurück. Max hatte sie aufgeschnallt und immer wieder gefragt: "Hast du noch keine Angst?" und "Willst du den Namen nicht nennen?" Sie verneinte immer wieder, und nach 35 Minuten schnallte er sie ab und sie wurde mit den Worten "Na feige bist du ja nicht" und einem Fußtritt entlassen. Was wir beide empfanden , als wir uns wiedersahen, kann kein Mensch ermessen, und in diesem Moment gelobten wir uns: Weg vom Stutthof, sobald wie möglich und ganz gleich wohin! Eines Tages wurden wir alle aus Baracke 18a in einer anderen Baracke untergebracht. Dort schliefen wir auf der Erde, aufeinander, der ganze Ba-rackenflur war voller Menschen, und sogar im Wasch- und Toilettenraum hatten sich einige hingelegt. Am Abend wurde in vielen Baracken aussortiert. Neben uns war eine leere Baracke, in der die weinenden Menschen untergebracht wurden, und am Morgen in aller Frühe wurde der traurige Zug fortgebracht. Durch unsere neue Blockälteste, eine Russin, gelang es uns, ein 12jähriges Mädel, das mit ausgesucht worden war, vor dem sicheren Tode zu retten. Sie ist bis zur Befreiung bei uns gewesen. Im Lager waren fast alle Baracken verlaust, denn für uns Juden war ja alles gut genug. In jeder freien Minute sahen wir unsere Sachen nach, nahmen jede Gelegenheit wahr, um uns waschen zu können, wenn auch nur unter Schlägen. Oft sogar wachten wir die Nächte, um in den Duschraum zu verschwinden und uns zu säubern. Es ist uns Gott sei Dank gelungen, während der ganzen Zeit im Lager frei von Ungeziefer und ansteckenden Krankheiten zu bleiben.
Wieder wurde in der Schreibstube eine Nacht durchgearbeitet. Arbeitskommandos wurden zusammengestellt. Wir 36 Frauen aus der Schreibstube schrieben unsere Nummern mit in die Listen und wurden am anderen Morgen um 4 Uhr mit abgerufen für ein Arbeitslager von 1700 Frauen. Dann wurde uns gesagt, daß wir noch zum Duschen in den großen allgemeinen Baderaum gehen müßten. Dort wurde uns alles abgenommen, sogar die Kopftücher und die Schuhe, soweit sie noch gut erhalten waren. Nackt mußten wir uns anstellen und bekamen statt unserer wenigstens guten, sauberen Zebrakleidung gewaschene Lumpen, einen Schlüpfer, ein Hemd und einen grauen Sträflingskittel, ganz gleich, ob es passend war oder nicht, ein Paar Holzschuhe, einen Lumpen zum Abtrocknen und einen als Kopftuch. Strümpfe gab es nicht. So hatten wir gar nichts mehr, nicht einmal eine Nadel und ein Stückchen Garn, um einen Riß zuzunähen. Unter Schimpfen und Püffen ging's dann Mantel in Empfang nehmen. Mäntel, die nur noch die Bezeichnung "Lumpen" verdienten. Es war glühend heiß, die Sonne brannte unbarmherzig. Ein Haufen übelriechender, total verdreckter Männermäntel, teils zerrissene Pelze, die man verschiedenen Zivilgefangenen abgenommen hatte, wurden verteilt. Die meisten ekelten sich, diese Lumpen auch nur anzufassen, aber es half nichts, wir mußten sie anziehen, obwohl wir vor Hitze und Durst bald umkamen. Jetzt erhielt jeder noch eine Decke, eine Blechschüssel, einen Löffel und Lagerration für drei Tage und dann zogen wir ab unter Bewachung von 72 Mann litauischer SS und einem SS-Oberscharführer als Kommandanten.
Unser Weg führte durch einen dichten Wald, und da wir nur Schreie und Schimpfen hörten, wurde uns angst und bange, fast alle glaubten, dieser Wald sei unser Friedhof. Endlich erlaubte der Kommandant, daß wir uns hinlegten und etwas aßen. Dann ging's noch etwa 20 Kilometer weiter bis zu einer kleinen Bahnstation, wo wir in kleinen offenen Güterwagen Platz nehmen mußten. Platz ist übertrieben, denn der vorhandene Raum reichte nicht einmal zum Stehen für alle. Es waren schöne, fruchtbare Ebenen, durch die wir fuhren. Wir atmeten auf. Unsere Hoffnung sproß aufs neue.
Aus dem Kleinbahnzug wurden wir in Marienburg in einen sauberen Personenzug verladen, und dort hatten fast alle Sitzplätze. Es war das erstemal in vier Jahren, daß wir in einem Personenzug befördert wurden, daß wir ohne Stacheldraht waren, daß wir miteinander frei reden konnten ohne Wachen, und schon sprachen wir davon: "Wenn wir mal frei werden". Und doch sollten noch viele von uns auf der Strecke bleiben. Eine Nacht fuhren wir so, am anderen Morgen wurden wir in Argenau ausgeladen. Nach einem ungefähr zweistündigen Marsch kamen wir an eine Waldlichtung, in der eine kleine Zeltstadt aufgebaut war. Finnenzelte, jedes von ihnen berechnet zur Einstellung von zwölf Pferden — man brachte in jedem 60 Frauen unter. Eine Küche war im Freien vorhanden, sechs große 300-Liter-Kessel. Kartoffeln waren auch schon im Lager vorhanden, und so kochten wir noch am Abend eine Suppe von ungeschälten, kleingeschnittenen Kartoffeln. Inzwischen war etwas Stroh in jedes Zelt gebracht worden, und nach dem Essen gingen alle zur Ruhe. Es war Spätsommer und noch warm, also das Leben in Zelten noch auszuhalten. Am nächsten Morgen wurden Arbeitskolonnen zusammengestellt, und mit geschultertem Spaten ging's hinaus zur Schanzarbeit, von bewaffneten SS-Posten begleitet. Das Leben war erträglich. Der Kommandant, der zum ersten Male ein Lager führte und keine Ahnung von allem hatte, war auf unsere Kenntnisse angewiesen. Nur mit den Posten war es schwer. Der litauische Wachführer, ein SS-Hauptscharführer, sagte zu uns, er habe in Kowno und Schaulen bis an die Hüften in Judenblut gewatet, und wir sollten uns vor ihm hüten.
Das Leben ging seinen Gang. Wir bekamen unsere Suppe und unser Brot und fast täglich 28 g Margarine oder Marmelade, so daß wir trotz schwerer Arbeit immer hoffnungsvoller wurden. Fast jeden Tag kamen Trupps von Wehrmachtsoldaten durch unser Lager. Sie sprachen mit uns und ließen sich erzählen, was wir mitgemacht hatten. Sie waren ganz entsetzt und sagten uns, daß von all dem die deutsche Bevölkerung nichts wüßte. Als die Soldaten sahen, daß die litauischen Posten beim Essensempfang und auch sonst die Frauen schlugen und anschrien, verboten sie ihnen eine solche Behandlung.
Die Litauer fluchten und schlugen weiter. Auch ich habe in den ersten Tagen einen Kolbenschlag auf die linke Hüfte bekommen, das Bein ist heute noch nicht in Ordnung. Nach ungefähr drei Wochen waren an dieser Stelle die Arbeiten vollendet, und wir zogen weiter. Nach einem etwa zehnstündigen Marsch kamen wir in ein Barackenlager bei Schlüsselmühle. Dieses Lager war vorher ein russisches Gefangenenlager gewesen, jetzt wurde es getrennt, die eine Seite für uns, die andere für die Russen, die durch Stacheldraht von uns getrennt waren und von Wehrmachtsoldaten bewacht wurden. Unsere Wachen begannen nun zu trinken, da eine Stadt in der Nähe war, wo Alkohol zu bekommen war. An manchem Abend wurde getrunken und geschossen, und auch unser Kommandant begann zu trinken. Inzwischen kam zur Beaufsichtigung des Lagers ein alter Hauptmann der Wehrmacht, der zwar bemüht war, den Lagerinsassen gerecht zu werden, der aber viel zu engstirnig und zu energielos war, um den SS-Wachen Achtung abzunötigen. Lettinnen und Litauerinnen, die sich mit den Wachposten verständigen konnten, arbeiteten in der Proviantur. Zwischen diesen, der Wache und auch dem Kommandanten entwickelte sich eine Art Vertraulichkeit. Des öftern saßen sie an den Abenden zusammen, diese Mädel bekamen so etwas mehr zu essen als das Gros der Häftlinge.
In unserer Nähe lag ein Wehrmachtskommando, dessen Hauptmann aus Westfalen war. Dieser kam fast täglich ins Lager und fragte, ob man uns auch anständig behandle. Von den Soldaten bekamen wir oft Brot. Sie waren immer sehr anständig zu uns. Es handelte sich um Frontsoldaten, die für einige Zeit hierher in Ruhestellung gekommen waren. Alle, einschließlich der Vorgesetzten, wußten nichts von den Vorgängen in den KZ-Lagern. Als eines Nachts betrunkene Wachen zu den Frauen, die in der Küche schliefen, eindrangen und auch der Kommandant in betrunkenem Zustand zusammen mit der Wache begann, wie wild in der Küche herumzuschießen, kamen mehrere Offiziere der Wehrmacht herüber, vertrieben die Wache, machten dem Kommandanten schwere Vorwürfe und sagten, daß sie die Sache zur Meldung bringen wollten. Zwei Tage später mußten wir abmarschieren und kamen in das Waldlager Korben bei Thorn. Inzwischen herbstelte es schon, und wir fragten uns maches Mal: Wie werden wir den Winter ertragen?
Nun will ich das Lager Korben ein wenig schildern, damit die Leser das Kulturniveau dieser Zeltlager besser beurteilen können. Zwei Pumpen, von denen meistens nur eine in Ordnung war, lieferten das Wasser für 1.700 Häftlinge, die Privatwohnung der beiden Kommandanten und die Küchen. Waschvorrichtungen für die Häftlinge waren nicht vorhanden. Ergatterte ein Zelt (60 Frauen) mit Mühe einen Marmeladeneimer, so ersetzte dieser die Wasch- und Duschräume für die 60 Frauen, und doch wusch sich jede Frau, die etwas auf sich hielt, täglich vom Kopf bis zu den Füßen mit kaltem Wasser ab. Als Creme benutzten wir einen Teil der zugeteilten Margarine, da uns die Hautpflege wichtiger war, als die winzige Zuteilung aufs Brot zu schmieren. Eine Frau wartete auf die andere, um sich zu waschen.
Als wir dann im November für jedes Zelt einen kleinen Ofen bekamen, wurde fast jedes Zelt nach Arbeitsschluß zu einer Badestube. Die Frauen standen nackt um den Ofen herum und ließen sich trocknen, denn Handtücher waren im Lager eine Rarität und Kostbarkeit. Inzwischen kam für unsere Proviantur ein Verpflegungschef von der NSV ins Lager, ein Gasthaus- und Kinobesitzer Stahnke aus Thorn. Von ihm können wir alle nur sagen, daß er einer der anständigsten Menschen war, mit denen wir während der Häftlingszeit zu tun hatten, der auch unseren Kommandanten im guten Sinne beeinflußte.
Da wir ein Zweiglager vom Stutthof waren, wurden von dort die Befehle herausgegeben. Hätte man in Stutthof gewußt, daß nur ein Fünkchen menschliches Gefühl in unseren Kommandanten und Vorgesetzten war, sie wären mit sofortiger Wirkung abgelöst und durch SS-Bestien ersetzt worden. Der Wehrmachthauptmann, der unserem Kommandanten beigegeben war, wurde abgelöst von einem alten KZ-Hasen, dem Sturmscharführer Wilhelm Anton. Auch er wurde von den beiden anderen zum Guten beeinflußt und war zu ertragen, gemessen an dem, was wir in anderen Lagern erlebten. Vielleicht lag es auch daran, daß wir selbst strengste Disziplin in bezug auf Sauberkeit und Ordnung hielten, um den Seuchen, die so viele Arbeitslager ausgerottet hatten, entgegenzuarbeiten. Das bitterste Kapitel in diesen Zeltlagern waren die Latrinen. Wir Frauen mußten tiefe Gruben auswerfen, etwa 150 bis 200 Meter von den Zelten entfernt. Am Rande dieser Gruben mußten wir uns hinsetzen, um unsere Notdurft zu verrichten.
Der Winter setzte ein. Gefrorene Kartoffeln, Freibankfleisch, roh gegessene Gemüseabfälle taten das übrige: Magen- und Darmkatarrh brachen aus, Dysenterie wurde die Lagerkrankheit; dazu kamen eitrige Wunden, Erfrierungen, Phlegmone, Angina, Diphtherie und Scharlach. Nach Rücksprache mit dem Kommandanten wurde zu dem sogenannten Krankenzelt noch ein Zelt für ansteckende Krankheiten hinzugenommen. Alle Zelte waren natürlich den Witterungseinflüssen stark ausgesetzt. Bei Regen und Schnee lief die Feuchtigkeit durch die Ritzen der Sperrholzplatten, aus denen die Zelte zusammengesetzt waren. Oft war das Innere der Zelte eine große Wasserlache, da ja kein Fußboden vorhanden war. Die Frauen schritten zur Selbsthilfe. Sie gruben etwa einen Meter breite und anderthalb Meter tiefe Gfäben um jedes Zelt und häuften die ausgeworfene Erde an den Außenwänden auf. Dann deckten sie die Zeltdächer mit Moos und umflochten alle Zelte mit Tannengrün, damit die Feuchtigkeit und der Frost etwas abgehalten wurden. Als der Winter fortschritt und es noch kälter wurde, mehrten sich die Erkrankungen. Blasen- und Nieren- sowie Unterleibserkrankungen kamen hinzu. Keine Krankheit konnte man ausheilen, da jeder sich beim nächtlichen Gang zur Latrine aufs neue erkältete. Manche Kranke kamen gar nicht mehr bis zur Latrine; allmorgendlich mußten die Wege von menschlichen Exkrementen gereinigt werden. Wir taten wirklich alles, was in unseren Kräften stand. Kam eine SS-Kommission vom Stutthoff, fand sie ein sauberes Lager, dessen Prozentsatz an arbeitenden Kräften bedeutend höher war als in allen anderen Außenlagern. Doch es sah nur so aus. Alles wurde zur Arbeit geschickt, ob mit Erfrierungen, Dysenterie, mit Phlegmonen, mit Eiterungen, bis Herz- oder Körperschwäche eintrat und der Betroffene sich zum Sterben hinlegte.
Hier muß ich einfügen, daß unser Lager zum größten Teil aus ungarischen Frauen bestand, die von Auschwitz nach Stutthof gekommen waren. Von den 1.700 Frauen waren 1.500 Ungarinnen, der Rest aus der Tschechei, aus Polen und Litauen und nur 36 aus Deutschland. Erst später, nachdem wir für 40 schwerkranke Frauen 40 Ersatzfrauen aus Stutthof bekamen, waren wir 50 Frauen aus Deutschland. Warum nur so wenig Frauen aus Deutschland? Es war ein Prinzip der SS, nur ausländische Frauen zu Arbeitskommandos ins Reich zu schicken, sie wollten verhindern, daß sie mit der Bevölkerung Fühlung nahmen. Diese ungarischen Frauen waren schon in sehr zerstörter geistiger Verfassung aus Auschwitz gekommen. Alle trugen ihre Häftlingsnummer im linken Unterarm eintätowiert. Viele dieser meist blendend schönen Ungarinnen hatten jeden Lebenswillen verloren. Sie wollten sich nicht mehr waschen und säubern, aßen alle Abfälle, die sie fanden, sie bekamen Kleiderläuse, und es war an ihnen eine unglaubliche Reinigungsarbeit zu leisten, damit sie nicht ganz verkamen. Manche waren aber nicht mehr zu retten. Wochen- und monatelanger Durchfall hatte die Körper bis zu Skeletten abgezehrt, sie wurden von Läusen überfallen, so daß oft der ganze Körper von diesem Ungeziefer übersät war. Wir hatten allen Frauen anempfohlen, die Wäsche, die wir doch täglich tragen mußten, in der Nacht ausfrieren zu lassen und nackt in den Decken zu schlafen, aber den meisten war es zu kalt, da sie zum größten Teil erst im selben Jahr von zu Haus gekommen waren und ja auch einem wärmeren Klima entstammten. Sehr viele von ihnen hatten den Verstand verloren, so daß jede Mühe, die man sich mit ihnen machte, vergebens war.
Nachdem schon etwa 40 Frauen gestorben waren, erhielten wir vom Stutthof einen Lastwagen mit Kleidungsstücken, Wäsche und Strümpfe oder Strumpfersatz, aus Stoff genähte Füßlinge. Die Sachen wurden verteilt. Jeder bekam eine Garnitur gestreifte Häftlingswäsche, einen Mantel, einen Pullover, ein Paar Strümpfe oder Füßlinge und ein Paar Handschuhe. Jedenfalls hatten wir jetzt etwas auf dem Leibe. Trotzdem war der großen Kälte wegen die Sterblichkeit nicht aufzuhalten. Wir hatten fast jeden Tag vier bis fünf Tote, so daß ein Beerdigungskommando geschaffen werden mußte. Um jeden Toten, der der Erde übergeben werden mußte, gab es eine Auseinandersetzung mit dem Kommandanten um eine Decke oder einen Papiersack, um die Leichen einzuhüllen. Der Befehl vom Stutthof besagte, daß die Leichen nackt eingegraben werden müßten.
Auch Kinder wurden im Lager geboren, zumeist nur von ungarischen Mädchen und Frauen, die bei der Einlieferung in Auschwitz aus dem Duschraum geholt und von der SS vergewaltigt worden waren. Sogar 14jährige waren darunter. Vier Kinder sind geboren worden, drei davon verstarben, weil sie nicht lebensfähig waren. Eines blieb am Leben. Aber auch dieses Kind wurde ein Opfer der Exekution, die beim Näherrücken der russischen Front von den SS-Wachposten vorgenommen wurde. Die litauischen SS-Wachtposten waren unsere Peiniger. Auf den Arbeitsstellen wurden die Frauen wegen geringfügiger Vergehen oder einfach aus Willkür mit Kolbenschlägen traktiert, häufig wurden Frauen blutend und mit zerbrochenen Rippen ins Lager zurückgebracht. Tapfere Helden waren das, die ihr Mütchen an wehrlosen Frauen kühlten, aber das Wort Partisanen konnte ihnen Angst und Bange einjagen. In einer bitterkalten Nacht, ich hatte gerade Kesselwache und saß auf einem der angewärmten Kaffeekessel und hatte mich mit meiner Decke zugedeckt, zerrisen Pistolenschüsse die Luft, denen Gewehrschüsse folgten. Die vor dem Lager ausgestellten Wachposten antworteten ebenfalls mit Gewehrschüssen, und die ganze Wachmannschaft kam, bis an die Zähne bewaffnet, aus ihren Zelten herausgestürzt. Manche waren so betrunken, daß sie sich kaum auf den Beinen halten konnten. "Partisanen haben sich gezeigt; den ganzen Wald durchkämmen", lautete das Kommando, und 72 Mann, an der Spitze der Kommandant, rannten wild schießend in den Wald.
Ich war ruhig auf meinem warmen Platz sitzengeblieben und besah mir die Szenerie im Mondschein. Zur Erklärung muß ich hinzufügen, daß unsere Küche aus sechs im Freien aufgestellten großen Kesseln bestand, die von einem auf Pfählen ruhenden Dach überdeckt waren. Nach vorn war die Küche ganz offen, die beiden Seitenwände und die Rückwand mit Birkenreisern durchflochten. So saß ich und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Hoffentlich sind es die Russen, so dachten wir in diesen Minuten wohl alle. Da sah ich ein weißes Etwas unter dem nächsten Kessel verschwinden. Ich ging hinzu und rief, und hervor kam der kleine weiße Hund des litauischen Wachkommandanten, der bei jedem Schuß zusammenzuckte. Langsam ging mir ein Licht über die Zusammenhänge auf, und meine Vermutung sollte richtig gewesen sein.
Das Knallen verstummte, und unsere tapfere SS kehrte ins Lager zurück. Der Kommandant ging mit den Wachen in die Zelte und kam um 4 Uhr früh total betrunken zu mir an den Kessel, jetzt erfuhr ich, was sich zugetragen hatte. Der Wachkommandant hatte mit seinem Adjutanten und mehreren Scharführern am Abend sehr viel getrunken, bis sich alle total betrunken in Uniform und Stiefeln auf die Betten geworfen hatten. Nur der Hauptscharführer hatte noch vorher die Stiefel ausgezogen. Neben seinen Füßen lag, wie immer, sein kleiner weißer Hund. Sei es nun, daß er sich bewegt und den Hund getreten hatte, kurzum, das Vieh biß ihn in den Fuß. Betrunken wie er war, glaubte er sich überfallen, riß die Pistole heraus und schoß — seinem Adjutanten durch den Stiefel. Der, auch aus seinem kurzen Rauschschlaf aufgeschreckt, schoß wieder, und schon war die Wache alarmiert und der „Partisanenkampf" ohne einen einzigen Partisanen bis zum letzten Schuß durchgeführt.
Jeden Morgen war Zählappell, manches Mal auch Schüssel- und Deckenappell. An einem Morgen stellte man beim Deckenappell fest, daß 80 gute Decken fehlten. Der Kommandant sagte: "Ihr habt auf der Arbeitsstelle den Polen die Decken verkauft. Wenn innerhalb drei Tagen die Decken nicht zurück sind, werden zur Strafe 80 Weiber nach Stutthof zurückgeschickt, und ihr wißt ja, was das heißt." Die Frauen beteuerten, daß sie die Decken nicht verkauft hätten. Einige Frauen legten sich nun während des Tages auf die Lauer, und meine Tochter fragte einige polnische Bauern, die ins Lager kamen, ob sie noch Decken kaufen wollten. Darauf bejahten sie, sagten aber, daß sie nur neue Decken nähmen, solche, wie ihnen die Wachposten verkauft hätten. Inzwischen war auch ein Posten von den Frauen beobachtet worden, wie er morgens während des Appells zwei Decken aus unseren Zelten holte. Wir meldeten dem Kommandanten diese Vorfälle, und er ließ daraufhin die Wachen kontrollieren, den Ertappten verhören, und dieser verriet auch noch neun seiner Komplicen. "Der Bunker muß gereinigt werden, Freiwillige vor", so hieß es beim Appell. Keiner wollte, denn alle waren müde vom Kommando gekommen. Als sie aber hörten, daß Wachposten eingesperrt werden sollten, meldeten sich alle ausnahmslos zu dieser Arbeit. Im Nu war der Bunker sauber und zehn SS-Leute eingesperrt. Diese wurden am nächsten Morgen zum Stutthof abtransportiert. Später kamen zehn andere dafür zurück. Das Betreten des Terrains um die Wachbaracken wurde am nächsten Morgen beim Appell verboten.
Beim Betreten des abgesteckten Gebietes sollte gleich scharf geschossen werden. Wir dachten erst, es sei darum, um zu verhindern, daß Mädel aus dem Lager in die Wachbaracken geholt wurden. Später klärte sich die Sache auf. Ärzte kamen ins Lager und gingen in die Wachbaracken. Später flüsterte man überall im Lager, es sei bei der Wache Flecktyphus ausgebrochen. Vom Stutthof aus kam auch eine Ärztekommission, die alle Frauen untersuchte, da die Wachposten behaupteten, von den Frauen mit Typhus infiziert worden zu sein. Alle waren niedergeschmettert, denn wir wußten, wurde ein Fall entdeckt, legte man das ganze Lager um. Trotz sorgfältigster Untersuchung konnte jedoch nichts gefunden werden; der Kelch war noch einmal an uns vorübergegangen.
Einige Tage später waren zwei geistesgestörte Mädel dem Lager entlaufen und nicht wieder aufzufinden. Der Befehl des Kommandanten lautete, daß 100 Frauen als Geiseln zum Stutthof zurück müßten, wenn die beiden nicht gefunden würden. Jeder von uns dachte doch nur mit Schrecken an ein Zurückkehren in diese Hölle, wußten wir doch, daß wir dann Todgeweihte waren. Deshalb beteiligten sich viele Frauen an der Suche nach den Verschwundenen. Man fand sie schlafend in einer Grube im Walde, etwa acht Kilometer vom Lager entfernt. Sie hatten sich die Grube selbst ausgeworfen, sich dann mit dem Spaten jede eine tiefe Schädelwunde beigebracht, sich in ihre Decken eingerollt und in die Grube gelegt, um zu sterben. Wie traurig muß es um die Gemütsverfassung eines 17jährigen Mädels aus einer ungarischen Juristenfamilie ausgesehen haben, bis ein solch intelligentes Menschenkind, das fünf Sprachen perfekt beherrschte, dem Wahnsinn zum Opfer fiel?
Beide Mädel waren total verlaust, sie wollten sich nicht mehr waschen, nur sterben wollten sie. Wir waren einige Sozialistinnen im Lager und einige Jugendliche, die durch die Jugendbewegung gegangen waren, wir hatten genug zu tun, um dieser geistigen Infektion ein Gegengewicht zu geben. Wir hatten sehr viele gute Künstlerinnen im Lager und veranlaßten diese, sich in den Zelten vor ihren Kameradinnen zu produzieren. Bald hatte sich in fast jedem Zelt eine kleine Gruppe gebildet, die zur Unterhaltung der anderen Leidensgefährten ihr möglichstes tat. Und sehr viele wurden durch diese abendlichen Unterhaltungen aus ihrem Trübsinn aufgescheucht. Die beiden Mädel wurden, nachdem sie ein zweites Mal aus dem Krankenrevier entflohen waren, erschossen.
Nach diesem Fall begann unser junger Kommandant furchtbar zu trinken, scheinbar um sich zu betäuben, da er nicht zu den abgebrühten SS-Leuten gehörte. Dann gab es trotz aller Trübsal für uns manchmal etwas zum Lachen, da er sich dann als Kunstschütze betätigte. Einmal waren es die Schornsteine der Küche und der Zelte, dann waren es Küchengeräte, die ihm als Zielscheiben dienten. Einmal war es ein Faß mit sehr flüssiger Marmelade, die natürlich auslief. Dann rief er, daß jeder sich von der Marmelade nehmen könne, und schon stürzten Hunderte ungarischer Frauen auf die Marmelade. Hände und Gesichter waren schrecklich verschmiert, aber immer wieder versuchten sie alle, noch etwas von der süßen Masse zu ergattern. Ein anderes Mal hoben Frauen eine Schmutzgrube aus, in der sich schon Abfälle und menschliche Exkremente gesammelt hatten. Der Kommandant, der wieder angesäuselt war, wollte den Frauen zeigen, wie sie fachgemäß ausschachten müßten und fiel dabei in die etwa anderthalb Meter tiefe Grube, aus der ihn vier kräftige Frauen nur mit Mühe und Not herausholten, von oben bis unten verdreckt. Jedoch muß man ihm nachsagen: war er auch noch so betrunken, bösartig war er nie. Um so mehr waren dies die litauischen SS-Wachen; wenn sie betrunken waren, wurden sie entweder zu liebenswürdig zu den Frauen, oder sie mißhandelten sie brutal. Ich bin auch dreimal im Dunkeln das Opfer ihrer betrunkenen Wut geworden, als ich gezwungen war, in der Nacht die Waldlatrine aufzusuchen. Schuld an der Einstellung und dem Benehmen der Wachposten war der Kommandant der Wache, ein richtiger SS-Mörder, der, wenn unsere Kommandanten nicht gebremst hätten, sämtliche Frauen, mit Ausnahme von ein paar Lettinnen vielleicht, die ihm die Nächte versüßten, umgelegt hätte.
Eines Tages kam ein Befehl vom Stutthof, daß Häftlinge nicht mehr geschlagen werden dürften, um die Arbeitskraft nicht zu vermindern. Bekleidungsstücke vom Stutthof wurden geschickt, da die Bevölkerung der Umgebung darüber sprach, wie die zerlumpt aussehenden Frauen, oft ohne Strümpfe, in Holzschuhen, in ihre Decken eingewickelt in Schnee und Regen im tiefsten Winter ihre schwere Arbeit verrichteten. Die meisten hatten Arme und Beine bedeckt mit tiefen eitrigen Frostwunden.
Entlausung
Einige Tage vor Weihnachten sagte uns der Kommandant, daß auf der Station Birglau, etwa vier bis sechs Kilometer vom Lager entfernt, ein Entlausungszug der deutschen Wehrmacht stände und das ganze Lager dorthin müßte. Jetzt erst sah man, wie viele dieser jungen Frauen und Mädchen abgemagert und voller Geschwüre waren, wie der Vitaminmangel diese Körper zugerichtet hatte. Nach diesem Weg zur Entlausung in klirrendem Frost sind sehr viele krank geworden, und etwa zwanzig starben infolge Lungenentzündung und Herzschwäche.
Der junge Kommandant Heinrich Binding aus Elbing kam aus seinem Weihnachtsurlaub zurück. Inzwischen war unser Proviantmeister abberufen und durch einen sehr verknöcherten, engstirnigen, älteren NSV-Beamten ersetzt worden. Wir bemerkten bei allen Vorgesetzten eine immer größere Nervosität. Der Kommandant hatte sich einen Radiokofferapparat mitgebracht, und in dem kleinen Schreibstubenzelt ertönte häufig am Tage Radiomusik. Vergaß er am Abend, den Koffer abholen zu lassen, was sehr oft vorkam, so stellten wir das Ausland ein und hörten dadurch so manches von der Front. Es war für uns besonders interessant, weil wir die ganzen Jahre doch von der Außenwelt abgeschlossen waren. Nachts horchten wir angestrengt auf die Stimmen der Front. Vorerst hörten wir nur bei Fliegerangriffen die Bomben fallen. Das war Musik in unseren Ohren. Wir ahnten schon, daß bald die Stunde der Befreiung kommen würde. "Das Lager muß geräumt werden, wir gehen weiter ins Reich hinein", so lautete die Parole, die vom Kommandanten beim Abendappell herausgegeben wurde. Am nächsten Morgen mußten alle früh antreten. Proviant wurde verteilt. Die meisten Frauen hatten sich schon aus Papiersäcken oder anderen Lumpen Umhängebeutel oder Rucksäcke gemacht, in denen man den Wegproviant und die paar Habseligkeiten unterbrachte. "Der SD holt die Frauen, die nicht laufen können, und die Insassen des Reviers mit Wagen ab", sagte der Kommandant. Zehn Wachposten blieben bei diesen Frauen im Lager zurück. Wir wußten, was das bedeutete, denn wir kannten die litauischen Mordbuben. Wir warnten die Frauen und sagten leise zu jeder: "Meldet euch, daß ihr laufen könnt, es geht um euer Leben". Es gelang uns noch, einen kleinen Teil der Frauen, die.sich vorher marschunfähig gemeldet hatten, mitzunehmen. Traurigen Herzens ließen wir 183 Frauen und Kinder im Lager zurück.
Durch Eis und Schnee ging's fort. Wir ahnten die Schwere des kommenden Weges, kannten wir doch die Methoden der SS, hatten doch einige von uns den Geheimbefehl vom Stutthof gesehen, in dem geschrieben war: "Es muß dafür Sorge getragen werden, daß beim Näherrücken der Front kein Häftling lebend in die Hände der Feinde fällt." Der alte Kommandant Wilhelm Anton, in der Nähe von Berlin beheimatet, sagte zu mir, als wir ausmarschierten: "Sage den Frauen, daß sie unter keinen Umständen im Lager bleiben sollen, und mache jede darauf aufmerksam, nur ja weiterzulaufen." Die Kräftigeren nahmen die Schwächeren zwischen sich, damit keine zurückbleiben sollte. Kaum waren die letzten Frauen etwa hundert Meter vom Lager entfernt, als wir schon das grausame Knattern der Maschinengewehre hörten. Es war so, wie wir gefürchtet hatten, der SD brauchte nur noch Leichen abzuholen. Kein Wort wurde bei uns gesprochen.
Allen wurden die Herzen schwerer. "Wer wird die Nächste sein?" war die bange Frage, die sich jede vorlegte. Schwerer und schwerer wurde der Weg, denn wir mußten uns durch verschneite Wälder durchkämpfen. Die Landstraßen durften von uns nicht begangen werden, da die Trains der deutschen Flüchtlinge mit Pferd und Wagen die Straßen verstopften. Müder und müder wurde der lange Zug der Schicksalsgenossinnen, doch so nahe am Ziel wollte keine auf der Strecke bleiben. Hinter uns lauerten die 62 Litauer auf jede, die zu versagen drohte. Die erste Frau fiel hin, und ehe die zunächst Gehenden begriffen hatten, was los war, hörten wir einen Knall. Eisig griff es uns ans Herz. Der Wachkommandant sagte zu seinen Leuten: "Wer von den Weibern zurückbleibt, wird sofort umgelegt." Ich notierte mir den Namen der Frau, die erschossen worden war, um später an geeigneter Stelle die nötigen Angaben machen zu können. Wir baten den Kommandanten, doch der Wache das Schießen zu verbieten. Was er mit dem litauischen Hauptscharführer sprach, weiß ich nicht, jedenfalls mordeten die Bluthunde weiter. Mitten in der Stadt Bromberg, auf der Danziger Straße, rissen sie die Frauen aus den Reihen, schleppten sie in einen Hausflur oder eine Toreinfahrt, erschossen sie und ließen die Leichen liegen. Auf diese Weise sind auf dem Weg, der in vier Tagen ungefähr 96 Kilometer betrug, noch 87 Frauen erschossen worden.
Bromberg lag hinter uns, am Standrande wurde eine kurze Rast gemacht. Mit Schnee feuchteten wir die aufgesprungenen Lippen an und löschten unseren Durst. Plötzlich machte mich meine Tochter darauf aufmerksam, daß die Wache die Patronengurte offen über die Schulter schnallte, und der litauische Oberbluthund mit beiden Kommandanten verhandelte. Wir schlichen uns unauffällig in die Nähe und hörten, wie der Wachkommandant unsere Kommandanten bat, ihm doch die Judenweiber zu überlassen, er würde es genauso machen wie in Litauen und alle im Wald umlegen. Sie selbst würden dann versuchen, der schon sehr nahe gekommenen Feindfront zu entkommen. Während noch hin- und hergeredet wurde, kam der SS-Hauptscharführer Blatterspiel, einer, der auch Hunderte von uns auf dem Gewissen hatte, auf einem Motorrad in rasendem Tempo auf uns zu. Ich machte den alten Kommandanten aufmerksam und sah dann, daß der Angekommene einen Briefbogen in der Hand hielt.
Schon stieg er ab und meldete dem Kommandanten: "Befehl der Berliner Regierung, es darf kein Häftling mehr getötet werden, jeder Lagerleiter haftet mit seinem Kopf für die ihm anvertrauten Gefangenen." Auf die Frage: "Was hast du denn mit deinem Lager gemacht?" sagte Blatterspiel: "Ich laß die Weiber laufen, wohin sie wollen; von 800 habe ich noch 35, die anderen sind getürmt. Ich werde meinen Kopf retten, alles andere ist mir schnuppe."
Obwohl dem Wachkommandanten der Befehl verlesen wurde, verlangte er die Frauen für seine Leute, da er andernfalls mit der Wache türmen würde. Der Alte schrie, er solle machen, daß er fortkäme mit seiner ganzen Mordbande, sonst jage er ihm eine Kugel durch den Kopf. Die total betrunkenen Litauer zogen ab, und wir glaubten uns schon gerettet. Wir übernachteten auf einem Gut, etwa 13 Kilometer hinter Bromberg; am anderen Morgen verschwanden auch unsere Kommandanten auf Nimmerwiedersehen. Der Ältere, so hörten wir später, soll sich erschossen haben. Obschon wir die Frauen energisch warnten, sich draußen sehen zu lassen, liefen verschiedene Ungarinnen auf der Chaussee herum. Dort hielt sie ein motorisierter SS-Mann an, dem die Häftlingskleider verdächtig waren, und fragte sie nach woher und wohin. Die dummen Ungarinnen antworteten ihm, daß im Gut ein Judenlager untergebracht sei, dessen Kommandanten und Wachposten entlaufen seien, und sie jetzt nicht wüßten, was sie tun sollten. Schon am Spätnachmittag kam eine SD-Kontrolle von Bromberg, und am Abend hatten wir schon neue Wachmannschaften, Feldgendarmerie und Volkssturm; am nächsten Morgen um 7 Uhr ging es weiter.
Überall auf den Landstraßen sahen wir deutsche Wehrmachtangehörige oder Truppenteile in regelloser Flucht. Das Heer befand sich in Auflösung. Wir ahnten, daß uns die Freiheit winkte, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkäme. Viele unserer Frauen waren noch in der Nacht entlaufen; was aus ihnen wurde, wissen wir nicht. Das schlimmste war, daß die polnischen Fuhrleute, die unsere Proviantwagen gefahren hatten, mit diesen Proviantwagen und etwa zehn lettischen und litauischen Frauen ausgerückt waren. Die Frauen sahen sich schon verhungern. Es kostete uns paar deutschen Jüdinnen große Mühe, die aufgeregten Frauen zu beruhigen, doch auch das gelang. Als am späten Abend unsere neuen Wachmannschaften kamen, mußten wir noch die ganze Nacht für sie kochen; von ihnen erfuhren wir auch, nachdem der auf dem Gut in großen Mengen vorhandene Alkohol die Zunge gelöst hatte, daß wir am nächsten Morgen nach Koronowo an der Brahe gebracht werden sollten, um dort im Zuchthaus die Nacht zu verbringen. Dort bekam die Wache von dem SD neue Instruktionen für den Weitertransport.
Am Morgen ging dann der beschwerliche Marsch Richtung Koronowo los. Die Wachmannschaften ließen uns gewähren, als wir von den verlassenen Gütern Wagen und Pferde requirierten, um diejenigen, die nicht mehr laufen konnten, aufzuladen. Gegen 7 Uhr abends kamen wir im Zuchthaus an. Dort bekamen wir noch warme Suppe und Brot, und die Beamten, vielfach Polen, waren sehr nett zu uns. Einer, der wußte, was mit uns geschehen sollte, erzählte meiner Tochter, daß wir am Morgen von der Konitzer SS abgeholt und im Wald bei Könitz erschossen werden sollten. Die ganze Nacht über schlief er nicht, sondern saß mit noch einigen Beamten mit meiner Tochter zusammen, und sie überlegten, wie man unsere 997 Frauen (die anderen waren ja schon fortgelaufen) retten konnte. Aber ein anderer griff ein. Um 5 Uhr früh begann eine heftige Schießerei, einige Bomben fielen, und um 8.47 Uhr öffneten die Russen die Tore unseres Gefängnisses; wir waren frei. Etwa 20 Kranke brachten wir in das städtische Krankenhaus, und die übrigen fanden Wohnung in den von Deutschen verlassenen Häusern.
Meine Tochter wurde gleich als Feldscher im Spital des Zuchthauses eingestellt, das nun ein Gefangenenlager für Deutsche und eingedeutschte Polen wurde. Wir blieben bis zum Ende des Jahres 1945 in Polen, doch die Sehnsucht nach den Angehörigen und das Heimweh trieben uns nach Hause. Am 2. Januar 1946 trafen wir in Berlin ein; hier begann ich gleich mit diesen Aufzeichnungen, um einen Beitrag zur Aufklärung unseres Volkes zu geben.
Jeanette Wolff: "Ich habe Riga überlebt", Zitat aus "Mit Bibel und Bebel: ein Gedenkbuch"
Orginal: University of Michigan, USA. Erschienen in Deutschland bei Neue Gesellschaft, 1981
Andreas Jordan, Januar 2010
Mit freundlicher Unterstützung von
Gelsenzentrum – Portal für Stadt- und Zeitgeschichte